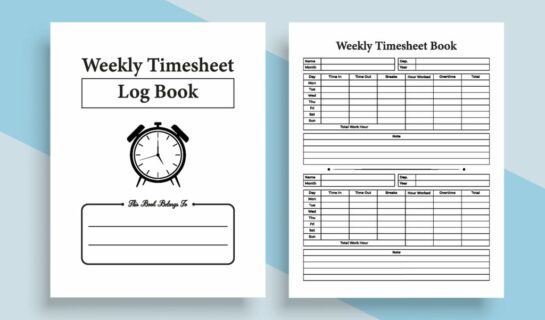OLG Bamberg – Az.: 5 U 84/13 – Beschluss vom 07.10.2013
I. Der Senat beabsichtigt, die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Würzburg vom 09.04.2013, Az. 64 O 669/12, gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen, weil er einstimmig der Auffassung ist, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, der Rechtssache auch keine grundsätzliche Bedeutung zukommt und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts erfordert. Auch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung über die Berufung ist nicht geboten.
II. Der Senat beabsichtigt weiterhin, der Beklagten die Kosten des Berufungsverfahrens gemäß § 97 Abs. 1 ZPO aufzuerlegen und den Streitwert für das Berufungsverfahren auf € 23.000,- festzusetzen.
III. Hierzu besteht Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 30. Oktober 2013.
Gründe
I.
Der Senat ist einstimmig der Auffassung, dass die Berufung auch unter Berücksichtigung des Berufungsvorbringens offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, weil das angefochtene Urteil weder auf einer Rechtsverletzung beruht noch die zugrunde zu legenden Tatsachen eine andere Entscheidung rechtfertigen (§§ 522 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 513 Abs. 1, 529, 546 ZPO).
II.
Das Landgericht hat mit der angefochtenen Entscheidung dem auf die Rücktrittserklärung vom 17.06.2011 gestützten Begehren der Klägerin auf Rückabwicklung des mit der Beklagten am 08.06.2005 geschlossenen Vertrages über den Einbau von Feuerschutzvorhängen am Bauobjekt der Fa. A. GmbH in B. stattgegeben und die Beklagte zur Rückzahlung des erhaltenen Pauschalpreises von 23.000,- € zzgl. Zinsen verurteilt. Es hat nach Beweisaufnahme festgestellt, dass die Vorhänge sich in einer Vielzahl von Fällen vor und nach der Abnahme am 04.04.2007 nicht ordnungsgemäß absenkten, die Anlage bei verschiedenen Überprüfungen „einmal funktioniert und einmal nicht“. Die Anlage sei deshalb mangelhaft im Sinne von § 633 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB, nämlich in keinem Zustand, der „für eine Anlage, die dem Schutz auch von Menschenleben dient, hinnehmbar wäre“ (LGU 8). Die der Beklagten gesetzten Nachbesserungsfristen (letztmals bis Ende August 2009) seien erfolglos abgelaufen, weitere Fristen zur Nacherfüllung der Klägerin nicht zumutbar (LGU 11). Die Verjährungseinrede der Beklagten hat das Landgericht nicht durchgreifen lassen.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die ihren Antrag auf Klageabweisung weiterverfolgt. Sie rügt, das Erstgericht habe zu Unrecht aus den Funktionsstörungen der Vorhänge (Rauchschürzen) auf einen von der Beklagten zu verantwortenden Mangel der Anlage geschlossen und hierbei die Darlegungs- und Beweislast der Parteien verkannt. Zum Zeitpunkt des Rücktritts im Jahre 2011 hätten die Schürzen funktioniert. Probleme davor seien wohl auf Verschmutzung der Führungsschienen zurückzuführen, was der Beklagten nicht angelastet werden könne. Das Schreiben vom 04.08.2009 stelle keine taugliche Fristsetzung für einen zwei Jahre später erfolgten Rücktritt dar; seit der Wartung 2010 habe die Anlage funktioniert. Gewährleistungsansprüche der Klägerin seien verjährt; es gelte die zweijährige Verjährungsfrist des § 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B 2002.
Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil als richtig und beantragt die Zurückweisung der Berufung.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf das angefochtene Urteil sowie auf die Berufungsbegründung und die Berufungserwiderung Bezug genommen.
III.
Der Senat hat bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage die vom Landgericht in rechtsfehlerfreier Weise getroffenen Tatsachenfeststellungen gemäß § 529 Abs. 1 ZPO seiner Entscheidung zugrundezulegen.
Die Beweiswürdigung des Landgerichts ist rechtlich fehlerfrei. Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die Zweifel an der Richtigkeit und der Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen. Zweifel im Sinne des § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO liegen nur dann vor, wenn aus der für das Berufungsgericht gebotenen Sicht eine gewisse, nicht notwendig überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass im Falle der Beweiserhebung die erstinstanzlichen Feststellungen keinen Bestand haben werden, sich also deren Unrichtigkeit herausstellt (BGH NJW 05, 1583; 04, 2828; 04, 2825). Es genügt, wenn das Berufungsgericht aufgrund konkreter Anhaltspunkte in einer rationalen und nachvollziehbaren Weise zu vernünftigen Zweifeln kommt, d. h. zu Bedenken, die so gewichtig sind, dass sie nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen werden können (BGH NJW 04, 2828). Konkreter Anhaltspunkt ist dabei der objektivierbare rechtliche oder tatsächliche Einwand gegen die erstinstanzlichen Feststellungen. Anhaltspunkte für Zweifel an der Richtigkeit oder der Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen können sich dabei auch aus Verfahrensfehlern ergeben, die bei der Feststellung des Sachverhalts unterlaufen sind (BGH NJW-RR 09, 1193; BGH MDR 05, 1308; BGH NJW 04, 2152; 04, 1876). Dies gilt insbesondere dann, wenn in der ersten Instanz Beweise fehlerhaft oder unzureichend erhoben oder gewürdigt wurden (BGH NJW-RR 09, 1193; BGH NJW 05, 1583, 04, 2152).
Die Beweiswürdigung durch das Gericht bestimmt sich dabei nach § 286 ZPO. Danach ist der Richter dazu aufgefordert, nach seiner freien Überzeugung zu entscheiden. Dies bedeutet, dass der Richter lediglich an die Denk- und Naturgesetze sowie die bestehenden Erfahrungssätze gebunden ist, ansonsten aber die im Prozess gewonnenen Erkenntnisse grundsätzlich ohne Bindung an gesetzliche Beweisregeln nach seiner individuellen Einschätzung bewerten darf und muss. Der Vorgang der Überzeugungsbildung ist nicht von objektiven Kriterien abhängig, sondern beruht auf Erfahrungswissen und Judiz des erkennenden Richters (vgl. BGH NJW 08, 2845 m.w.N.; vgl. auch zum Ganzen Zöller, ZPO, 28. Aufl., § 286 Rn. 13). Eine Behauptung ist bewiesen, wenn das Gericht von ihrer Wahrheit überzeugt ist, ohne dabei unerfüllbare Anforderungen an deren Nachweis zu stellen (BGH WM 98, 1689). Für den Nachweis genügt, da eine absolute Gewissheit nicht zu erreichen und jede Möglichkeit des Gegenteils nicht auszuschließen ist, ein für das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit. Dieser erfordert einen für einen vernünftigen, die Lebensverhältnisse klar überschauenden, besonnenen, gewissenhaften und lebenserfahrenen Menschen so hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, dass er den Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (BGH NJW 08, 2845; BGH NJW 08, 2846 jeweils m.w.N.). Nach § 286 Abs. 1 ZPO bezieht sich die Beweiswürdigung auf den gesamten Inhalt der mündlichen Verhandlung und des Vortrages der Parteien. Beweise müssen dabei vollständig gewürdigt und der dem Gericht unterbreitete Sachverhalt umfassend ausgeschöpft werden (BGH NJW 08, 2845 m.w.N.; BGH NJW-RR 04, 425). Verwertbar sind dabei auch Äußerungen bei einer Anhörung gemäß § 141 ZPO (vgl. Zöller a.a.O. § 286 Rn. 14; § 141 Abs. 1 Rn. 1 unter Hinweis auf BGH NJW 99, 363). Das Gericht beurteilt den Wert der einzelnen Beweismittel unter Berücksichtigung der ihnen eigenen Fehlerquellen (BGH NJW 98, 2736; Thomas/Putzo, ZPO, 30. Aufl., § 286 Rn. 2 a). Die ausdrücklich in § 286 Abs. 1 ZPO vorgesehene Würdigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses der Beweisaufnahme nach freier Überzeugung gibt dem Richter die Möglichkeit, unabhängig von Partei- und Zeugenstellung die Aussagen gegeneinander abzuwägen und zu bewerten (vgl. BVerfG NJW 01, 2531; BGH NJW-RR 06, 61; BGH NJW 03, 3636).
Unter Berücksichtigung dieser Rechtsgrundsätze ist die durch das Landgericht Würzburg vorgenommene Beweiswürdigung rechtlich nicht zu beanstanden. Das Landgericht hat insoweit auch nicht verkannt, dass der Klägerin – nach erfolgter Abnahme vom 04.04.2007 – die Darlegungs- und Beweislast dafür obliegt, dass das Werk der Beklagten mangelhaft im Sinne von § 633 Abs. 1 und 2 BGB war. Die im Urteil geschilderten Funktionsstörungen der Brandschutzvorhänge in den Jahren 2007 bis 2010 werden auch von der Beklagten nicht (mehr) in Abrede gestellt. Einzuräumen ist der Berufung, dass solche Störungen bei einer technischen Anlage verschiedene Ursachen haben können, u. a. sicherlich auch auf Bedienungsfehler und auf unterlassene Wartung zurückgeführt werden mögen. Die Beklagte übersieht aber, dass sich das Landgericht aufgrund seiner Beweisaufnahme davon überzeugt hat, dass solche nicht in den Verantwortungsbereich der Beklagten fallenden Ursachen auszuschließen sind. Damit hat es aber Zweifel, die zu Lasten der Klägerin gingen, eben nicht (mehr) gehabt, sondern die Verantwortlichkeit für die Funktionsstörungen – wenn auch ihre genaue Ursache offenbleiben musste – nachgewiesenermaßen bei der Beklagten gesehen. Die Erstrichterin hat diesen Schluss auch überzeugend und fehlerfrei damit begründet, dass das Hängenbleiben der Rauchschürzen „über Jahre“ (LGU 8) hinweg trotz vielfältiger zwischenzeitlicher Nachbesserungsversuche der Beklagten immer wieder auftrat. Sie weist mit Recht insbesondere auch auf die Zeit vor der Abnahme hin, in der bereits (nach Aussage des Zeugen E., Bl. 84 d. A., beginnend eine Woche nach Fertigstellung, am 06.07.2005) immer wieder Probleme mit dem Herunterlaufen der Schürzen auftraten, die – vorläufig – abzustellen die Beklagte seinerzeit bis zur Erreichung der Abnahmereife bereits fast zwei Jahre Mühen und Arbeit kosteten. Die Berufungserwiderung (S. 4) führt zutreffend aus, dass „die nach der Abnahme auftretenden Funktionsstörungen identisch mit den bereits vor der Abnahme immer wiederkehrenden Problemen“ waren. Auch der Senat geht deshalb von einer durchgehenden „Leidensgeschichte“ aus, bei der es immer wieder zum Hängenbleiben der Vorhänge, die nicht wie erforderlich bis zum Boden herabliefen, kam. Es erscheint völlig abwegig, dass anlässlich der diversen Abhilfebemühungen die Mitarbeiter der Beklagten nicht auf angebliche Bedienungsmängel hingewiesen hätten oder eventuelle Verunreinigungen der Schienen, so sie denn vorgelegen haben, nicht moniert worden wären. Der vom Landgericht gezogene Schluss, dass solche in der Sphäre der Benutzer liegenden Ursachen für die Fehlfunktionen auszuschließen sind, ist deshalb logisch, naheliegend und überzeugend.
Mit Recht hat das Landgericht auch eine Verursachung der Funktionsstörungen durch unzureichende Wartung der Anlage verneint (LGU 10). Richtig ist zwar, dass ein entsprechender Wartungsvertrag von der Bauherrin erst im Dezember 2008 (Anlage K 10) abgeschlossen wurde. Bis dahin waren aber wegen der vom Zeugen D. (Bl. 82, 83 d. A.) bekundeten und in der Berufungserwiderung (S. 5 und 6) nochmals im einzelnen dargestellten und durch die in erster Instanz vorgelegten Unterlagen bestätigten Mängelrügen immer wieder Mitarbeiter der Beklagten oder der von ihr beauftragten und später auch mit den Wartungsarbeiten betrauten Fa. C. sowieso vor Ort, um Funktionsstörungen zu beseitigen. Diese (Nachbesserungs-)Arbeiten waren – da sie ja zumindest zu einem kurzfristigen Funktionieren der Rauchschürzen führten – reinen Wartungsarbeiten wohl sogar überlegen, konnten sie aber jedenfalls effektiv ersetzen. Interessant ist in diesem Zusammenhang insbesondere auch, dass anlässlich des mit Anlage K 24 dokumentierten Termins als Mangelbeseitigungsmaßnahme zusätzliche Gewichte in einen der Vorhänge eingebracht wurden, um hierdurch offensichtlich ein besseres Herunterlaufen zu erreichen. Auch diese Tatsache spricht deutlich für konstruktionsbedingte und gegen anwenderverursachte Probleme, stützt daher die Überzeugung des Landgerichts, dass letztere als Ursache der Funktionsstörungen ausscheiden. Auch anlässlich der zwischen dem 11.05.2007 und dem 29.11.2007 durchgeführten Nacherfüllungsbemühungen wurden weder der Klägerin noch der Bauherrin Vorwürfe gemacht, die Führungsschienen seien unzulässigerweise verschmutzt und Ursache der aufgetretenen Probleme.
In den Jahren 2009 (15.04.) und 2010 (06.05.) wurden dann die jährlich vorgegebenen Wartungsarbeiten auch durchgeführt. Es mag zwar sein, dass die im zweiten Wartungsbericht (Anlage B 3) angeführte „extreme“ Verunreinigung der Führungsschienen für das bei der damaligen Prüfung zunächst erneut festgestellte Hängenbleiben verantwortlich war. Der Senat lässt es auch ausdrücklich offen, ob die vom Landgericht für erforderlich gehaltene Abdichtung der Schienen tatsächlich Sache der Beklagten war (wofür allerdings vieles spricht). Die in diesem einen Fall möglicherweise für die Funktionsstörung ursächliche Verschmutzung erklärt aber jedenfalls nicht, dass es auch nach der ersten Wartung vom 15.04.2009 erneut zu Funktionsstörungen gekommen ist, die der Zeuge E. für den 18.05., 22.07. und 04.08.2009 bekundete (Bl. 85 d. A.) und auch vom Sachverständigen R. des mittlerweile von der Fa. A. angestrengten selbständigen Beweisverfahrens 2 OH 11/09 LG Mosbach am 11.02.2010 festgestellt wurden. Die auf diese Tatsache gestützte Überzeugung des Landgerichts (LGU 10) von einer der Beklagten zuzurechnenden Mangelhaftigkeit ihres Werkes lässt deshalb keinen Fehler erkennen und hat Bestand.
Soweit die Beklagte eine eigene Beweiswürdigung in der Berufungsbegründung vornimmt und diese an die Stelle der Beweiswürdigung, die das Gericht vorgenommen hat, setzt, führt dies nicht dazu, dass die Feststellungen des Landgerichts in rechtlich fehlerhafter Weise getroffen worden wären. Die Würdigung der erhobenen Beweise und des gesamten Prozessstoffes ist die ureigenste Aufgabe des erkennenden Gerichts. Deren Durchführung wird nicht allein deshalb unrichtig, weil die Beklagte der Auffassung ist, dass die Würdigung der Beweise anders, nämlich in ihrem Sinne, vorzunehmen sei.
Nach alledem sind die Feststellungen des Landgerichts rechtsfehlerfrei getroffen worden, so dass sie der Senat bei der Entscheidung gemäß § 529 Abs. 1 ZPO zugrundezulegen hat.
IV.
Ist das Werk – wie festgestellt – mangelhaft, kann der Besteller gemäß §§ 634 Nr. 3, 636, 323 und 326 Abs. 5 BGB von dem Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht des Werkvertragsrechts des BGB ist vorliegend nach der richtigen und auch von der Berufung nicht mehr in Frage gestellten Auffassung des Landgerichts nicht durch die erfolgte Vereinbarung auch der VOB/B ausgeschlossen (LGU 6, BBgrdg. S. 2).
Voraussetzung für einen wirksamen Rücktritt, wie er vorliegend mit Schreiben vom 17.06.2011 erklärt wurde, ist neben der Mangelhaftigkeit des Werkes grundsätzlich das ergebnislose Verstreichen einer dem Unternehmer gesetzten angemessenen Frist zur Nacherfüllung. Der Besteller muss dem Unternehmer eine „Zweite Erfüllungschance“ geben. Diese Voraussetzung ist im Streitfall in geradezu erschöpfender Weise erfüllt, worauf das Landgericht (LGU 11) und auch die Berufungserwiderung (S. 12) völlig zu Recht hinweisen. Die Klägerin und die Bauherrin haben der Beklagten über Jahre hinweg immer wieder Gelegenheit gegeben, ein funktionierendes Werk zu erstellen und für das erforderliche zuverlässige Absenken der Schutzvorhänge zu sorgen. Beide haben bei der Vielzahl der Nachbesserungsversuche eine geradezu „übermenschliche“ Geduld mit der Beklagten gezeigt. In dem Schreiben vom 04.08.2009 (Anlage K 8), das die Klägerin mit gleichlautender Aufforderung an die Beklagte weiterleitete, werden die zahlreichen erfolglosen Bemühungen der Beklagten bis zu diesem Termin sogar als „erster erfolgloser Nachbesserungsversuch“ zusammengefasst, ihr die zusätzliche Möglichkeit eines „zweiten Versuchs“ ausdrücklich eingeräumt und – angemessene – Frist zur Herstellung „endgültiger Funktionstauglichkeit“ bis Ende August 2009 gesetzt. Tatsächlich kam es aber in der Folgezeit zu keiner weiteren Nachbesserungstätigkeit seitens der Beklagten mehr; diese verneinte vielmehr mit Schreiben vom 29.09.2009 (Anlage BK 1) das Vorhandensein von Beschädigungen und stellte sich auf den Standpunkt, dass die Anlage funktioniere. Dementsprechend führte das Landgericht im unstreitigen Tatbestand der angefochtenen Entscheidung zutreffend aus, dass die Beklagte weitere Nachbesserungsarbeiten verweigerte. Diese Feststellung wird durch die vorgelegten Urkunden bestätigt und ist – nach Zurückweisung des Tatbestandsberichtigungsantrags der Beklagten – ebenfalls für den Senat bindend. Die Rücktrittsvoraussetzungen lagen somit spätestens mit Eingang des Schreibens vom 29.09.2009 bei der Klägerin vor.
Der Wirksamkeit des Rücktritts steht auch nicht die Tatsache entgegen, dass dieser erst lange nach Vorliegen seiner Voraussetzungen, nämlich am 17.06.2011, erklärt wurde. Nach (erfolglosem) Ablauf der zur Nacherfüllung gesetzten angemessenen Frist entstanden für die Klägerin die Gestaltungsrechte der §§ 634 Nr. 3, 636, 638 BGB auf Rücktritt oder Minderung. Bis zur Ausübung eines der Gestaltungsrechte hat der Besteller das volle Wahlrecht zwischen ihnen. Aus dem Schriftverkehr (Schreiben vom 04.08.2009 bzw. 29.09.2009) und auch aus dem mit Antrag vom 23.10.2009 eingeleiteten Beweisverfahren, in dem die Beklagte die Klägerin als Streithelferin unterstützte, ergibt sich, dass – für die Beklagte erkennbar – sowohl die Fa. A. als auch die Klägerin auch eine Minderung des gezahlten Werklohnes als Lösungsmöglichkeit des Streitverhältnisses betrachteten. Jedenfalls musste die Beklagte sowohl aufgrund ihres Ablehnungsschreibens vom 29.09.2009 (BK 1) als auch angesichts des darauf hin eingeleiteten Beweisverfahrens weiterhin mit der Geltendmachung auch sekundärer Gewährleistungsansprüche rechnen, zumal sie zu weiterer Nacherfüllung nicht mehr bereit war, sondern sich ja auf den Standpunkt gestellt hatte, die Anlage würde – jetzt – beanstandungsfrei funktionieren. Tatsächlich war dies aber – entgegen den Ausführungen der Berufungsbegründung – eben nicht der Fall, wie sich nicht nur aus der Feststellung des Sachverständigen beim (ersten) Ortstermin vom 11.02.2010 sondern auch aus der erstinstanzlich vorgelegten Übersicht Anlage K 17 und der Aussage des Zeugen S. ergibt (LGU 8). Danach ist nämlich die eine Rauchschürze im Jahre 2010 bei elf Versuchen immerhin achtmal, zuletzt im Oktober und November, nicht ordnungsgemäß heruntergefahren. Dies geschah, obwohl am 06.05.2010 eine Wartung – soweit ersichtlich die letzte vor Rücktrittserklärung – durchgeführt worden war. Die Klägerin hat auch nie nur den Anschein erweckt, sie würde von den ihr nach erfolglosem Fristablauf entstandenen Gestaltungsrechten keinen Gebrauch machen. Offensichtlich – das war auch der Beklagten als Streithelferin im Beweisverfahren klar – sollte durch die beantragte Begutachtung die konkrete Ursache des Funktionsmangels erforscht werden. Da dies aber zunächst auf Schwierigkeiten stieß, sich die Bauherrin schließlich zur vollständigen Umplanung entschloss und sich mit der Klägerin deshalb vergleichsweise einigte, entschied sich die Klägerin nunmehr, von dem ihr nach wie vor zustehenden Gestaltungsrecht Rücktritt Gebrauch zu machen und die Rückgängigmachung des mit der Beklagten geschlossenen Vertrages zu verlangen. Dies konnte sie in den durch einen möglichen Rechtsmißbrauch gesetzten Grenzen (Stichwort Verwirkung), die vorliegend durch den bloßen Zeitablauf nicht überschritten sind, auch problemlos tun. Durch die Erklärung des Rücktritts hat die Klägerin von dem ihr nach § 634 Nr. 3 BGB zustehenden Wahlrecht – jetzt bindend – Gebrauch gemacht und den Vertrag in ein Abrechnungs- und Abwicklungsverhältnis umgewandelt.
Die Gewährleistungsrechte der Klägerin und ihr aus dem Rücktritt resultierender Rückzahlungsanspruch sind auch nicht verjährt. Auf die zutreffenden Gründe der Erstentscheidung (LGU 6) wird Bezug genommen. Die Parteien haben im Vertrag vom 08.06.2005 (Anlage K 1) eine fünfjährige Gewährleistungspflicht für Mängelansprüche vereinbart, die – aus den vom Landgericht zutreffend zugrunde gelegten Gründen – bei Klageerhebung noch nicht abgelaufen war. Aus dem von der Beklagten zitierten Beschluss des OLG München vom 23.02.2010 – Az. 28 U 5512/09 – ergibt sich nichts anderes, weil dieser Entscheidung eine „völlig andere Fallkonstellation“ (so mit Recht die Berufungserwiderung, S. 2) zugrunde lag. Dort ging es um einen Generalunternehmervertrag über die Errichtung eines Geschäftsgebäudes einschließlich einer Aufzugsanlage, in welchem – pauschal und undifferenziert für einzelne Gewerke – abweichend von den in § 13 Nr. 4 Abs. 1 VOB/B 2002 enthaltenen Verjährungsfristen eine solche von fünf Jahren vereinbart wurde. Das OLG München hat sich der Meinung angeschlossen, dass jedenfalls dann, wenn die Regelung des § 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B 2002 nicht ausdrücklich abbedungen ist, die Vereinbarung längerer Verjährungsfristen als der in Abs. 1 der genannten Vorschrift aufgeführten Fristen nicht für die in Abs. 2 genannten wartungsbedürftigen Anlageteile gilt, wenn nicht auch deren Wartung dem Auftragnehmer übertragen wurde. Diese Meinung mag – wenn sie auch nicht unbestritten ist (vgl. LG Freiburg IBR 2001, 256) – durchaus richtig sein, hilft der Beklagten im Streitfall aber nicht weiter. Die Berufung verkennt, dass es vorliegend gerade nicht um ein „Gesamtbauwerk“ mit darin enthaltender technischer Anlage geht, sondern der Auftrag ausschließlich auf die Errichtung einer solchen Anlage gerichtet war. Andere Gewerke, für deren Mängel die Beklagte mit einer längeren als der Regelverjährungsfrist hätte haften sollen, gab es nicht. Die im Bezugsfall auftretende Problematik kann sich nur stellen, wenn neben unter § 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B 2002 fallenden – wartungsbedürftigen – „maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen“ weitere Bauleistungen an anderen Gewerken, die einer besonderen Wartung nicht bedürfen, beauftragt werden. In diesen Fällen kann tatsächlich zweifelhaft sein, ob der Auftragnehmer ohne dass ein erforderlicher Wartungsvertrag besteht, wirklich mit den verlängerten Fristen auch für diese – dann ungewarteten – Anlagen haften will. Im Gegensatz zu dieser Konstellation hatte vorliegend die Beklagte aber nur die streitgegenständlichen Rauchschürzen, also nur eine technische Anlage in obigem Sinne – zu errichten. Nur auf Mängel dieses Werks konnte sich denknotwendig die vereinbarte Verjährungsfristverlängerung beziehen. Wenn sich die Beklagte mit anderen Worten in Kenntnis der Wartungsbedürftigkeit, aber ohne gleichzeitig eine Wartung als unabdingbar zu vereinbaren, auf eine bestimmte Verjährungsfrist einlässt, so ist sie auch an diese Vereinbarung gebunden. Die vertragliche fünfjährige Verjährungsfrist ist daher – wie auch insoweit die Berufungserwiderung zutreffend ausführt – „eindeutig als abweichende und vorrangige Regelung zu § 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B a. F.“ (2002) zu verstehen.
V.
Nach alledem hat das Landgericht zu Recht der Klage stattgegeben. Aus diesen wesentlichen Gründen hat die Berufung der Beklagten daher offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg. Eine Entscheidung des Berufungsgerichts ist auch nicht wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache, zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten (§ 522 Abs. 2 S. 1 Nrn. 2 und 3 ZPO).
Eine mündliche Verhandlung in der vorliegenden Sache ist nicht geboten. Es ist auszuschließen, dass in einer mündlichen Verhandlung neue, im Berufungsverfahren zuzulassende Erkenntnisse gewonnen werden können, die zu einer anderen Beurteilung führen. Die vorliegende Entscheidung enthält auch keine Gesichtspunkte, die nicht bereits Gegenstand einer mündlichen Verhandlung waren.
Der Senat legt aus Kostengründen die Rücknahme der Berufung nahe. Auf die in diesem Fall in Betracht kommende Gerichtsgebührenermäßigung (vgl. KV Nrn. 1220, 1222) wird vorsorglich hingewiesen. Die Gerichtsgebühren verringern sich dann von dem 4,0-fachen auf das 2,0-fache der Gebühr.
Die beabsichtigte Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.