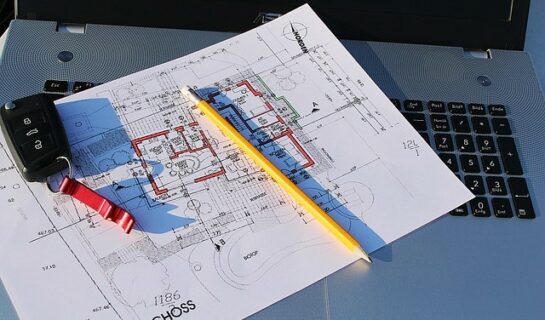Oberlandesgericht Schleswig-Holstein – Az.: 1 U 68/12 – Urteil vom 16.11.2018
Die Berufung der Klägerin gegen das am 27.04.2012 verkündete Urteil der Einzelrichterin der 2. Zivilkammer des Landgerichts Flensburg wird zurückgewiesen.
Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin bleibt nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % das aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Gründe
I.
Die Klägerin verlangt von dem Beklagten Schadensersatz wegen mangelhafter Bauaufsicht.
Mit Architektenvertrag vom 14.12.2004/01.02.2005 (Anlage K 1, Bl. 10 – 19 d. A.) beauftragte die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Fachklinik B. GmbH, den Beklagten mit der Planung und der Bauaufsicht für das Neubauvorhaben einer Tagesklinik in H..
Nach dem Einbringen des Estrichs im Zeitraum bis September 2006 wurden Trocknungsgeräte aufgestellt. In einem auf den 04.10.2006 datierten Baustellenprotokoll (Anlage K 15, Bl. 245 – 250 d. A.) hielt der Beklagte fest, dass am 27.09.2006 eine Restfeuchte von 3,5 % festgestellt worden sei. Nach einer Mitteilung von Herrn V. habe eine Kontrollmessung am 05.10.2006 ergeben, dass der Estrich verlegereif sei. Die Bodenbeläge wurden nach dem 05.10.2006 verlegt.
Auf dem Nachbargrundstück war etwa zeitgleich ein Neubau für eine andere Tagesklinik errichtet worden, bei dem der Beklagte ebenfalls als Architekt beauftragt gewesen war. Nachdem dort Feuchtigkeits- und Schimmelprobleme aufgetreten waren, ließ die Klägerin durch den Sachverständigen B. zwei Räume der Tagesklinik auf mögliche Schadstoff- und Schimmelbelastungen hin untersuchen. Der Sachverständige V. führte in seinem Gutachten vom 29.11.2008 (Anlage K 2, Bl. 20 – 37 d. A.) und seinem Ergänzungsgutachten vom 20.01.2009 (Anlage K 3, Bl. 38 – 47 d. A.) aus, er habe in insgesamt fünf Räumen einen erhöhten Feuchtigkeitsgehalt im Estrich sowie einen Schimmelpilzbefall festgestellt. Die Klägerin leitete daraufhin ein selbständiges Beweisverfahren vor dem Landgericht Flensburg (4 OH 32/08) u. a. gegen den Beklagten ein, in dem der Sachverständige K. ein Gutachten vom 10.04.2010 mit Ergänzungsgutachten vom 08.09.2010 und 17.11.2011 erstattete.
Die Klägerin hat mittlerweile den Fußbodenaufbau im gesamten Gebäude austauschen lassen. Sie hat in der Zeit dieser Arbeiten ihren Betrieb in andere Räume verlegt.
Die Klägerin hat behauptet, der Beklagte habe die Prüfung der Verlegereife nicht ordnungsgemäß überwacht. Die Verlegereife könne nicht erreicht gewesen sein. Es sei ausgeschlossen, dass die Feuchtigkeit innerhalb von 8 Tagen von 3,5 % auf unter 2 % gesunken sei. Zudem benötige Estrich eine Trocknungszeit von 56 Tagen. Der Estrich im Dachgeschoss sei aber erst ab dem 23.08.2006 gelegt worden, der Estrich im Erdgeschoss ab dem 28.08.2006. Der Estrich im Hausanschlussraum sei erst am 28./29.09.2006 gelegt worden. Der Beklagte habe das Risiko einer Rückfeuchtung des Estrichs nach dem Abbau der Trocknungsgeräte nicht bedacht.

Es sei die vollständige Erneuerung des Fußbodenaufbaus erforderlich gewesen, wofür Sanierungskosten in Höhe von insgesamt 253.644,71 € angefallen seien (Anlagen K 11, Bl. 259 d. A., K 16, Bl. 331 – 838 d. A.). Für den Zeitraum der Sanierungsarbeiten vom 01.07.2010 bis zum 30.05.2011 seien wegen der Verlegung des Betriebs in andere Räume Kosten in Höhe von insgesamt 61.052,49 € (Miete, Maklercourtage, Umbau-, Umzugs- und Einlagerungskosten) sowie ein Umsatzausfall in Höhe von 56.100,00 € entstanden (Anlage K 12, Bl. 260 – 262 d. A.).
Die Klägerin hat die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung von 370.797,20 € nebst Zinsen begehrt. Der Beklagte hat Klagabweisung beantragt.
Der Beklagte hat behauptet, vor Beginn der Bodenbelagsarbeiten seien am 05.10.2006 in seiner Anwesenheit durch Mitarbeiter der W. H. GmbH & Co. KG zwei Kontrollmessungen im Erdgeschoss und zwei Kontrollmessungen im Dachgeschoss durchgeführt worden, die eine Restfeuchte des Estrichs von weniger als 2 % ergeben hätten. Hinsichtlich dieser Messungen sei ein Protokoll erstellt worden, das er aufgrund des später über das Vermögen der W. H. GmbH & Co. KG eröffneten Insolvenzverfahrens nicht erhalten habe. Die Verlegereife habe vorgelegen, sonst hätten sich die Bodenbeläge lösen und das Parkett schüsseln müssen.
Das Landgericht, auf dessen Urteil wegen der weiteren Einzelheiten nach § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat nach der Vernehmung von Zeugen und der ergänzenden Befragung des Sachverständigen die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, es liege kein Überwachungsverschulden vor. Es sei nicht überzeugt, dass der Estrich nicht hinreichend trocken gewesen sei, als der Bodenbelag aufgebracht worden sei. Zwar habe der Sachverständige als Ursache für die Schimmelbildung die zu hohe Restfeuchte des Estrichs und u. U. des Betons angegeben. Aber die Zeugen V. und P. hätten angegeben, der Wert habe unter 2 % gelegen. Sie hätten zwar sonst ein Fehlverhalten offenbaren müssen. Ihnen sei aber das Risiko bekannt gewesen. Das Thema sei mehrmals besprochen worden, wobei der Beklagte darauf hingewiesen habe, dass der Estrich noch zu feucht gewesen sei. Nach der Aussage des Zeugen W. habe es keinen Zeitdruck gegeben. Es bestehe zwar die Möglichkeit einer fehlerhaften Messung, aber die Zeugen würden wegen des Haftungsrisikos sorgfältig gemessen haben. Zudem habe es keinen Schaden am Fußbodenbelag gegeben. Der Sachverständige habe nur andere Möglichkeiten ausgeschlossen, aber nicht eine Möglichkeit positiv festgestellt, auch nicht durch eigene Messungen vier Jahre später. Dabei habe der Feuchtigkeitsgehalt in fünf von sieben Proben unter 2 % gelegen. Auch seien die Messungen in dem Gebäude nicht durch offenbar gewordene Schäden oder Beschwerden veranlasst worden, sondern durch die Messergebnisse im Nachbargebäude.
Die Klägerin habe nicht bewiesen, dass der Beklagte seiner Überwachungspflicht nicht nachgekommen sei. Nach den Zeugenaussagen sei er bei den Messungen dabei gewesen. Er habe sich darauf verlassen dürfen, dass die Messungen ordnungsgemäß gewesen seien. Die Proben seien aus dem unteren Drittel des Estrichs entnommen worden, die Messungen seien durch Fachleute durchgeführt worden. Er hafte so nicht, selbst wenn der Estrich zu feucht gewesen sei.
Gegen dieses Urteil richtet sich die frist- und formgerecht eingelegte und begründete Berufung der Klägerin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, das Landgericht habe die Reichweite der Überwachungspflicht verkannt. Besonders gefahrträchtige Arbeiten seien besonders zu überwachen. Dazu gehörten Estricharbeiten, v. a. bei Besonderheiten, was das Landgericht nicht berücksichtigt habe. Die Stärke des Estrichs sei mit 7 cm oder sogar 8 cm größer als üblich gewesen. Es sei Schnellbinder verwendet worden. Es seien Trocknungsgeräte aufgestellt worden, so dass die Gefahr der Rückfeuchtung bestanden habe. Es habe besondere Warnsignale gegeben. So sei der Estrich bis Mitte der 34. KW verlegt worden, die Bodenbeläge seien ab der 39. KW verlegt worden, die Fliesen bereits ab der 37. KW, also vor der Messung. Noch am 27.09.2006 habe der Feuchtigkeitsgehalt 3,5 % betragen. Das Prüfprotokoll habe nicht vorgelegen. Nach dem Inhalt des Bauprotokolls sei der Beklagte bei der Messung nicht zugegen gewesen.
Der Sachverständige habe bestätigt, dass der Estrich zu feucht gewesen sei.
Das Landgericht habe die Beweislast verkannt. Es habe keine Teilabnahme der Leistungen des Beklagten nach Leistungsphase 8 gegeben, so dass ihn die Beweislast treffe. Der Beweis des ersten Anscheins spreche dafür, dass die Schimmelbelastung auf einer zu hohen Feuchtigkeit des Estrichs beruhe. Der Beklagte habe nicht nachvollziehbar dargelegt, wie es sonst zu den Feuchtigkeitsschäden gekommen sei. Die Aussagen der Zeugen reichten nicht, um das Gegenteil zu beweisen. Es sei ein Zirkelschluss anzunehmen, dass sie wegen des Risikobewusstseins sorgfältiger gemessen hätten.
Die Klägerin beantragt, unter Abänderung des am 27.04.2012 verkündeten Urteils des Landgerichts Flensburg (2 O 339/10) den Beklagten zu verurteilen, an sie 370.797,20 € nebst Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz auf 22.000,00 € seit Rechtshängigkeit und auf 348.797,20 € seit dem 23.08.2011 zu zahlen.
Der Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
Er verteidigt das Urteil des Landgerichts unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrages. Er behauptet, bei einer Begehung des Gebäudes sei es zu einer Teilabnahme seiner Leistungen gekommen. Die Klägerin habe auch seine Schlussrechnung bezahlt.
Auf die Hinweise des Senats haben die Parteien weiter vorgetragen. Die Klägerin trägt näher zu den Kosten des Fußbodenaustauschs vor. Wegen der Einzelheiten wird auf die Schriftsätze vom 22.08.2013 (Bl. 968 – 986 d. A.), 27.03.2014 (Bl. 1107 – 1115 d. A), 06.09.2014 (Bl. 1195 – 1205 d. A.) und 12.07.2015 (Bl. 1255 – 1277 d. A.) sowie die Anlagen K 19 – K 21 und K 25 – K 36 (AB) Bezug genommen.
Der Beklagte behauptet, auch ein Mitarbeiter des Unternehmens, das den Estrich gelegt habe, habe vor der Entfernung der Trocknungsanlage am 06.10.2006 eine Messung der Estrichfeuchte durchgeführt (Bestätigungsschreiben vom 25.05.2013, Anlage BB 3, AB).
Er wendet sich unter Vorlage von Stellungnahmen der Sachverständigen O. vom 20.12.2013 (Anlage BB 1, Bl. 1048 – 1085 d. A., AB), Z. vom 28.11.2016 (Anlage BB 4, Bl. 1412 – 1433 d. A.) und 05.09.2018 (Anlage BB 7, AB) sowie W. vom 24.11.2016 (Anlage BB 5, Bl. 1434 – 1444 d. A.) und 12.09.2018 (Anlage BB 8, AB) gegen die Ausführungen des Sachverständigen K..
Wegen der weiteren Einzelheiten des Vortrags der Parteien wird auf die zwischen ihnen gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Der Senat hat Beweis erhoben aufgrund des Beweisbeschlusses vom 29.08.2015 (Bl. 1279 – 1280 d. A.) und der Verfügungen vom 14.02.2017 (Bl. 1458 d. A.) und 22.03.2018 (Bl. 1584 d. A.) durch Einholung eines ergänzenden Sachverständigengutachtens, Vernehmung der Zeugen Kn., V. und P. sowie ergänzende Anhörung des Sachverständigen K..
Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Ergänzungsgutachten vom 25.06.2016 und das Protokoll des Termins vom 17.08.2018 (Bl. 1589 – 1604 d. A.) Bezug genommen.
II.
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht ist zu Recht zu dem Ergebnis gekommen, dass den Beklagten kein Überwachungsverschulden trifft. Soweit der Senat ursprünglich eine andere Auffassung vertreten hat (Hinweisbeschluss vom 26.04.2013, Bl. 949 – 951 d. A.), hat er später (Hinweisbeschluss vom 20.04.2015, Bl. 1209 – 1218 d. A.) deutlich gemacht, dass er daran nicht festhält.
1. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist der Senat davon überzeugt, dass der Beklagte seine Pflicht, die Bauarbeiten so zu überwachen, dass ein mangelfreies Gebäude entsteht, nicht verletzt hat. Jedenfalls ist eine Pflichtverletzung nicht kausal für den von der Klägerin behaupteten Schaden geworden.
a) Der bauaufsichtführende Architekt ist verpflichtet, vor der Verlegung von Bodenbelägen die Verlegereife zu prüfen oder entsprechende Messungen zu veranlassen (OLG Stuttgart, Urteil vom 09.01.2000, 13 U 43/00, Rn. 5 bei juris). Er muss die Messungen nicht selbst durchführen. Er muss sich aber Messprotokolle vorlegen lassen, um zu prüfen, ob Messungen in ausreichender Zahl an kritischen Stellen vorgenommen worden sind (OLG Frankfurt, Beschluss vom 26.02.2009, 22 U 240/05, Rn. 29 bei juris).
Danach genügte der Beklagten seiner Überwachungspflicht, wenn er vor der Verlegung des Bodenbelags Messungen der Verlegereife durchführen ließ und sich von deren Ergebnis überzeugte. Es ist unstreitig, dass der Beklagte mehrere Messungen hat durchführen lassen und zunächst wegen der fehlenden Verlegereife angeordnet hat, mit der Verlegung der Bodenbeläge noch nicht zu beginnen. Der Senat ist aufgrund der Aussage der Zeugen V., P. und Kn. zudem davon überzeugt, dass die Zeugen V. und P. am 05.10.2006 in Gegenwart des Beklagten vier Messungen der Feuchtigkeit im Estrich vorgenommen haben, diese jeweils Werte von unter 2 % ergaben und darüber ein Protokoll erstellt worden ist.
Die Zeugen V. und P. sind bereits vom Landgericht vernommen worden (Termin vom 23.08.2011, Prot. Bl. 263 – 272 d. A.). Das Landgericht hat ihre Aussagen im Urteil gewürdigt und sie für glaubhaft gehalten. Diese Beweiswürdigung hat die Klägerin mit der Berufung nicht erheblich angegriffen. Sie will die Beweiswürdigung des Landgerichts durch eine eigene Beweiswürdigung ersetzen, indem sie ausführt, die Zeugen hätten nur Vermutungen geäußert, die durch die Feststellungen des Sachverständigen widerlegt seien.
Der Senat hat sich dennoch entschlossen, die Zeugen V. und P. erneut zu vernehmen. Denn es war eine Grundlage für eine Gesamtwürdigung der Beweisaufnahme zu schaffen, in die unter anderem das Ergänzungsgutachten des Sachverständigen K. und seine Stellungnahme dazu sowie die Aussage des Zeugen Kn. einfließen musste. Es wäre dabei denkbar gewesen, dass die Aussagen anders als vom Landgericht zu würdigen gewesen wären. Was den Zeugen Kn. angeht, so war der Beweisantritt durch den Beklagten zwar neu. Es beruhte aber nicht auf Nachlässigkeit i. S. d. § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO, dass er in der ersten Instanz nicht benannt worden ist. Denn es ist nicht widerlegt, dass dem Beklagten seinerzeit nicht oder nicht mehr bewusst war, dass auch der Zeuge Kn. Messungen durchgeführt hatte.
Der Zeuge V. hat bekundet, er habe in Gegenwart des Beklagten vier Messungen der Estrichfeuchte durchgeführt, die jeweils unter 2 % ergeben hätten. Darüber sei ein Protokoll erstellt und von ihm, dem Zeugen P. und dem Beklagten unterzeichnet worden. Diese Aussage ist glaubhaft. Der Senat ist davon überzeugt, dass der Zeuge V. seine zutreffende Erinnerung an die damaligen Vorgänge zutreffend wiedergegeben hat. Er verkennt dabei nicht, dass die Bauzeit 12 Jahre zurückliegt und der Zeuge V. in der Zwischenzeit eine Vielzahl von ähnlichen Messungen durchgeführt hat. Dennoch ist die Aussage hinreichend detailliert. Sie beschränkt sich nicht auf die Angabe bestimmter unkritischer Messwerte. So wusste er noch, das in einigen Räumen Parkett verlegt worden war und in anderen Räumen Linoleum. Er konnte sich erinnern, dass die Fa. Bö. den Estrich gelegt und sie Trocknungsgeräte aufgestellt hatte. Auch konnte er ungefähr das Baujahr angeben. Diese Umstände zeigen, dass der Zeuge V. sich konkret an das streitgegenständliche Bauvorhaben erinnerte. Er hat auch deutlich gemacht, von welchen Umständen er keine Kenntnis hatte, etwa dem Verbleib der Messprotokolle, und welche Umstände er vergessen hat, etwa das Datum der Messung oder die genauen Messstellen. Das zeigt, dass er eine differenzierte Aussage gemacht hat, die sich auf seine Erinnerung beschränkte. So kann auch ausgeschlossen werden, dass er seine Angaben gemacht hat, um sich selbst zu entlasten. Er hätte dann um so mehr die Fehlerfreiheit seiner Arbeit betont. Zudem ist nicht erkennbar, dass er als bloßer Angestellter eines inzwischen insolventen Unternehmens Nachteile zu befürchten hätte, wenn er einen Fehler bei der Messung einräumte.
Die Aussage des Zeugen V. ist konsistent. Sie entspricht im Wesentlichen seinen Angaben vor dem Landgericht, die er sieben Jahre vor der Aussage vor dem Senat gemacht hat. Auch seinerzeit hat er sich darauf beschränkt, Umstände zu schildern, an die er sich erinnerte, da er eine Erinnerung an andere Umstände, wie das Datum der Messung oder den Verbleib des Protokolls, verneinte. Seinerzeit konnte er sowohl angeben, in welchen Räumen Messungen durchgeführt worden sind, als auch, welche Bodenbeläge verlegt worden sind. Dass er seinerzeit angab, der Zeuge P. habe das Protokoll nicht unterschrieben, und sich so damals oder bei seiner Aussage vor dem Senat geirrt haben muss, ist unschädlich, weil dieser Umstand nicht zum Kerngeschehen gehört. Ebenso ist es unschädlich, dass er sich seinerzeit nicht an Trocknungsgeräte erinnerte. Die Erinnerung kann durch die Erinnerung an den Estrichleger wieder geweckt worden sein.
Die Aussage des Zeugen V. wird im Kern bestätigt durch die Aussage des Zeugen P.. Auch er hat bekundet, dass in Anwesenheit des Beklagten vier Messungen durchgeführt worden sind, die jeweils Werte von unter 2 % ergeben haben, und darüber ein Protokoll erstellt worden ist. Auch der Zeuge P. konnte Einzelheiten dazu mitteilen, nämlich wo die Messungen durchgeführt worden sind. Auch er hat deutlich gemacht, wenn er von Umständen, wie dem Verbleib des Protokolls, keine Kenntnis hatte oder Umstände, wie den Zeitpunkt der Messung, vergessen hat.
Soweit die Angaben des Zeugen P. von denen des Zeugen V. abweichen, etwa zu dessen Anwesenheit bei den Messungen, der Durchführung an mehreren Tagen oder dem Grund der Anwesenheit des Beklagten, ist das dadurch zu erklären, dass er Einzelheiten verwechselt. Das hat er bei seiner Aussage eingeräumt. Es ergibt sich zudem aus seiner Aussage vor dem Landgericht. Seinerzeit hat er angegeben, die Messungen mit dem Zeugen V. gemeinsam durchgeführt zu haben, und von jedenfalls drei Messungen an einem Tag berichtet. Auch seinerzeit hat er deutlich gemacht, sich an bestimmte Umstände nicht zu erinnern. Er hat aber bekundet, der Beklagte sei bei der ersten Messung nicht dabei gewesen, dann aber sei er dazugerufen und ihm das Ergebnis gezeigt worden. Er habe darum gebeten, benachrichtigt zu werden. Er sei bis zum Schluss der Messung dabei geblieben. Es handelt sich dabei um ein originelles Detail, das für eine konkrete Erinnerung des Zeugen spricht. Denn es ist nicht zu erwarten, dass ein Zeuge eine solche Komplikation erfindet, wenn er nur übliche Abläufe bei der Messung des Feuchtigkeitsgehalts von Estrich schildert.
Die Aussagen der Zeugen V. und P. werden zudem durch die Aussage des Zeugen Kn. gestützt, soweit es den gemessenen Wert betrifft. Der Zeuge Kn. hat bekundet, die Fa. Bö. habe Trocknungsgeräte aufgestellt. Er habe eine CM-Messung durchgeführt. Er konnte zwar nicht sagen, welchen Wert diese ergeben hat, hielt es jedoch für wahrscheinlich, dass seine Angaben im Schreiben vom 24.05.2013 (Anlage BB 3, Bl. 1095 d. A., AB) zutreffend waren. In diesem Schreiben hat er angegeben, dass die Verlegereife erreicht gewesen sei. Auch wenn der Zeuge Kn. Einzelheiten zu der Verlegereife nicht mitteilen konnte, hat er bekundet, dass die Trocknungsgeräte erfahrungsgemäß stehen blieben, wenn die Verlegereife nicht erreicht sei. Das Unternehmen habe kein Interesse an einem Abbau, weil es an dem Einsatz der Geräte verdiene. Das ist unmittelbar einleuchtend. Insgesamt spricht die Aussage des Zeugen Kn. so für die Angabe der Zeugen V. und P., nach ihren Messungen sei die Verlegereife gegeben gewesen.
b) Es ist nach den Angaben des Sachverständigen nicht ausgeschlossen, dass die Messungen durch die Zeugen V. und P. Werte von unter 2 % ergeben haben. Das gilt trotz der Tatsache, dass am 27.09.2006 noch ein Wert von 3,5 % gemessen worden war. Er hat einen solchen Wert bei seiner Anhörung im Termin vom 17.08.2018 nur als unwahrscheinlich bezeichnet. Dasselbe hat er im Termin vom 23.08.2011 vor dem Landgericht angegeben. Im Gutachten vom 25.06.2016 hat er eine solche Abnahme für sehr unwahrscheinlich gehalten (S. 13). Als unmöglich hat er sie nicht bezeichnet.
Der Sachverständige hat vor dem Landgericht ausgeführt, die Trocknung hänge von verschiedenen Umständen ab, insbesondere der Wetterlage. Da die seinerzeit herrschende Wetterlage unbekannt ist und zudem unstreitig dem Estrich ein Schnellbinder zugesetzt war und Trocknungsgeräte aufgestellt worden waren, ist es nicht unmöglich, dass die von den Zeugen angegebenen Feuchtigkeitswerte tatsächlich zutrafen.
c) Dass die Zeugen V. und P. Fehler bei der Messung gemacht haben, die zur Anzeige eines zu niedrigen Feuchtigkeitsgehalt geführt haben, steht nicht fest.
aa) Die Zeugen V. und P. haben angegeben, sie hätten die Proben für die Messungen jeweils aus dem unteren Drittel des Estrichs entnommen. Der Sachverständige hat dazu in seiner Anhörung im Termin vom 17.08.2018 ausgeführt, die Probe müsse aus dem gesamten Querschnitt entnommen werden. Im unteren Teil der Estrichscholle sei die Feuchtigkeit höher. Grund dafür ist, dass der Estrich von oben austrocknet.
Indes führte das Vorgehen der Zeugen V. und P. dazu, dass die Messung einen höheren Wert ergeben haben, muss als wenn die Probe aus dem gesamten Querschnitt entnommen worden wäre, so dass auch trockenere Anteile aus dem oberen Bereich enthalten gewesen wären. Dieser Fehler führte nicht zu der Anzeige eines zu niedrigen Wertes.
bb) Der Sachverständige hat im Termin vom 17.08.2018 ausgeführt, dass die Probe zu lange geschüttelt worden sei. Sie dürfe nur zwei Minuten geschüttelt werden statt der von dem Zeugen V. angegebenen fünfzehn Minuten. Indes konnte der Sachverständige nicht aufklären, welche Folgen ein zu langes Schütteln hat.
Der Sachverständige Z. hat in seiner Stellungnahme vom 05.09.2018 (Anlage BB 7, S. 3 f.) ausgeführt, dass beim Schütteln Stahlkugeln in dem Messbehälter die Estrichprobe zerkleinerten, so dass Feuchtigkeit freigesetzt werde und mit dem beigefügten Calciumcarbid reagieren könne. Ein längeres Schütteln führe zu einer weiteren Zerkleinerung der Probe und so dazu, dass mehr Feuchtigkeit freigesetzt werde, so dass ein höherer Wert angezeigt werde. Das ist plausibel. Es ist physikalisch oder chemisch nicht nachvollziehbar, dass ein längeres Schütteln zu der Anzeige eines zu niedrigen Feuchtigkeitsgehalts führen soll. Demnach kann dieser Fehler für das Ergebnis ebenfalls nicht relevant sein.
cc) Es hätte zwar im Erdgeschoss eine Messung mehr durchgeführt werden müssen. Es steht aber nicht fest, dass eine weitere Messung zu dem Ergebnis geführt hätte, dass die Verlegereife nicht erreicht war.
Der Sachverständige hat ausgeführt (Gutachten vom 17.02.2011, S. 9 f.), dass nach dem Merkblatt des Bundesverbandes Estrich je angefangenen 200 m² eine Messung durchzuführen sei. Das hätte bedeutet, dass im Erdgeschoss des Gebäudes mit einer Fläche von gut 521 m² drei Messungen hätten durchgeführt werden müssen.
Es steht aber nicht fest, dass eine dritte Messung ein anderes Ergebnis erbracht hätte. Denn der Sachverständige hat in allen Räumen nahe beieinander liegende Feuchtigkeitsgehalte im Estrich gemessen (Gutachten vom 10.04.2010, Anlage 7). Er leitet daraus ab, dass linear zurückgerechnet bei der Verlegung der Fußbodenbeläge eine entsprechend höhere Feuchtigkeit vorgelegen hätte. Die Werte hätten dann aber ebenso eng beieinander liegen müssen. Dann konnte eine dritte Messung keinen erheblich von den beiden vorhergehenden Messungen abweichenden Wert ergeben.
dd) Selbst wenn den Zeugen V. und P. ein relevanter, zur Anzeige eines zu niedrigen Messwerts führender, Fehler unterlaufen wäre, musste der Beklagte ihn nicht erkennen. Der Architekt muss die Messungen des Bodenverlegers nicht überprüfen, weil er sich auf dessen Fachkunde verlassen darf (OLG Frankfurt, Beschluss vom 26.02.2009, 22 U 240/05, Rn. 29 bei juris). Ihm können nicht alle Einzelheiten des Messverfahrens bekannt sei.
Das hat der Sachverständige bei seiner Anhörung im Termin vom 17.08.2018 letztlich bestätigt. Er hat ausgeführt, Architekten seien selten mit CM-Messungen befasst. Auch er selbst habe nicht immer alle Werte im Kopf. So konnte er nicht angeben, welche Folgen es hat, wenn die Probe länger als zwei Minuten geschüttelt wird. Wenn aber nicht einmal ein Bausachverständiger, der sich auf den Termin vorbereitet hat, solche Einzelheiten kennt, kann von einem Architekten nicht erwartet werden, dass er sie im Rahmen der Bauaufsicht ständig parat hat.
d) Besonderheiten, die den Beklagten hätten veranlassen müssen, die von den Zeugen V. und P. gemessenen Werte kritisch zu hinterfragen, waren nicht gegeben.
aa) Die Estrichscholle war nicht unüblich dick. Der Beklagte musste so nicht mit einer deutlich längeren Trocknungszeit als üblich rechnen. Es bestand auch nicht die Gefahr, dass die Bodenleger in Unkenntnis der Dicke des Estrichs die Probe nur aus dem oberen, bereits stärker abgetrockneten Bereich entnahmen. Die von der Klägerin angegebenen Werte von 7 cm bis 8 cm sind von dem Sachverständigen nicht bestätigt worden. Bei den von ihm entnommenen Bohrkernen war der Estrich zwischen 5,5 cm bis 7,5 cm dick (Gutachten vom 10.04.2010, S. 12 ff.). Durchschnittlich hatte er also eine übliche Stärke. Das hat der Sachverständige im Gutachten vom 25.06.2016 (S. 12) und im Rahmen seiner Anhörung am 17.08.2018 bestätigt.
bb) Der bloße Umstand, dass Trocknungsgeräte aufgestellt waren, war kein Warnzeichen. Zwar ist es denkbar, dass eine Rückfeuchtung aus der Umgebungsluft stattfindet, nachdem die Geräte abgebaut sind. Indes hat der Sachverständige eine solche Rückfeuchtung bei seiner Anhörung vor dem Landgericht im Termin vom 23.08.2011 ausgeschlossen, weil das aufgrund der Dampfdruckverhältnisse nicht in Betracht komme. Bei der Anhörung im Termin vom 17.08.2018 hat er im Widerspruch dazu eine Rückfeuchtung zwar für möglich gehalten, jedoch angegeben, dass er das nicht feststellen könne, weil er die damalige Luftfeuchtigkeit nicht kenne. Da diese Verhältnisse nicht rekonstruierbar sind, kann nicht festgestellt werden, dass die Trocknungsgeräte einen relevanten Risikofaktor darstellten.
cc) Die seit Verlegung des Estrichs oder der Messung vom 27.09.2006 verstrichene Zeit war ebenfalls kein Warnzeichen. Wie bereits dargelegt, wäre es je nach den damaligen Witterungsverhältnissen möglich gewesen, dass die von den Zeugen V. und P. gemessenen Werte erreicht worden sind.
dd) Schließlich musste es auch nicht zu besonderer Vorsicht mahnen, dass bei der Verlegung des Estrichs ein Schnellbinder verwendet worden ist. Je nach Funktionsweise muss bei der Verwendung eines Schnellbinders weniger Anmachwasser verwendet werden (Gutachten des Sachverständigen K. vom 25.06.2016, S. 13) oder Wasser wird kristallin gebunden (Stellungnahme des Sachverständigen Z. vom 28.11.2016, Anlage BB 4, S. 19). In keinem Fall ist zu erwarten, dass eine Messung dahin beeinflusst wird, dass sie einen zu niedrigen Wert ergibt.
e) Es mag sein, dass der Beklagte das Prüfprotokoll hätte zur Bauakte nehmen müssen, ehe er mit den Bodenverlegungsarbeiten beginnen ließ. Ein solches Versäumnis ist aber jedenfalls nicht kausal für den von der Klägerin behaupteten Schaden geworden.
Nach § 15 Abs. 2 HOAI a. F. gehört es zu den Grundleistungen des Architekten, im Rahmen der Bauüberwachung u. a. Prüfprotokolle zusammenzustellen und sie dem Bauherrn zu übergeben. Der Beklagte hat das Prüfprotokoll nicht zur Akte genommen, weil er es von dem Unternehmen, das die Bodenverlegungsarbeiten ausgeführt hat, nicht erhalten hat.
Indes war er, wie oben festgestellt, zugegen, als die Messungen durchgeführt wurden, und hat die Ergebnisse zur Kenntnis genommen und das Protokoll abgezeichnet. Seine Entscheidung, die Bodenverlegung freizugeben, wäre nicht anders ausgefallen, wenn er den Eingang des Messprotokolls bei sich abgewartet hätte.
Zudem hätten sich in dem Protokoll keine Informationen befunden, die den Schaden vermieden oder auch nur die Rechtsposition der Klägerin verbessert hätten. Wie sich aus den von dem Sachverständigen K. (Gutachten vom 17.02.2011, Anlage 1) und der Klägerin (Anlage K 38, Bl. 1630 – 1643 d. A.) vorgelegten Mustern ergibt, sind in die Protokolle u. a. das Gewicht der Probe, der Wassergehalt und die Estrichdicke einzutragen. Soweit das von der Klägerin eingereichte Muster weiter vorsieht, dass klimatische Verhältnisse wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingetragen werden, galt das zur Bauzeit noch nicht. Das Muster stammt aus dem Jahr 2016. In dem von Sachverständigen vorgelegten Muster mit Stand 2005 waren solche Angaben nicht vorgesehen.
Aus dem Protokoll hätte sich so nur die Feststellung der Belegreife ergeben. Etwaige Fehler bei den Messungen, wie z. B. ein zu langes Schütteln, hätten sich aus dem Protokoll nicht ergeben.
2. Es steht nicht fest, dass ein etwaiges Verschulden des Beklagten bei der Überwachung der Verlegereifemessung für ein übermäßiges Schimmelwachstum im Fußbodenaufbau kausal war. Der Beweis des ersten Anscheins gilt dafür nicht. Angesichts der vielen möglichen Ursachen für eine erhöhte Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau, die Schimmelwachstum erlaubt, entspricht es nicht dem typischen Geschehensablauf, dass der Architekt eine zu hohe Feuchtigkeit des Estrichs vor dem Verlegen der Fußbodenbeläge übersehen haben muss.
Zweck der Belegreifeprüfung ist es, die Schadensfreiheit der Fußbodenbeläge zu erreichen. Dieser Zweck ist erreicht worden. Unstreitig wiesen die Fußbodenbeläge in dem Gebäude der Klägerin zu keinem Zeitpunkt Schäden auf.
Der Senat verkennt nicht, dass es ein Nebeneffekt der Belegreifeprüfung sein kann, dass die Restfeuchtigkeit im Bodenaufbau keine kritischen, ein Schimmelwachstum ermöglichenden Werte erreichen. So hat es der Sachverständige K. im Gutachten vom 25.06.2016 (S. 9, 18) ausgeführt. Indes ist Baufeuchte in einem Neubau unvermeidbar. Bei ungünstigen Verhältnissen kann die Feuchtigkeit in einzelnen Bauteilen so stark ansteigen, dass Schimmelwachstum möglich ist. Nach allgemeiner Kenntnis ist es deswegen etwa notwendig, in der ersten Zeit einen Neubau ausreichend zu heizen und zu lüften.
Eine solche Baufeuchte kann auch zu dem von dem Sachverständigen festgestellten Schimmelwachstum beigetragen haben. So führt er aus (Gutachten vom 10.04.2010, S. 32; Gutachten vom 17.02.2011, S. 8), dass im Obergeschoss auch Feuchtigkeit aus dem Beton der Decke zu der von ihm festgestellten Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau beigetragen haben kann. Auch der Sachverständige O. hat auf diese Möglichkeit hingewiesen (Stellungnahme vom 20.12.2013, Anlage BB 1, S. 22). Diese Feuchtigkeit war für den Beklagten unvermeidlich. Dem Senat ist aus einem anderen Verfahren bekannt, dass der Beton der Sohle und der Deckenplatte über geraume Zeit nach der Fertigstellung des Baus abtrocknet. Diese Feuchtigkeit konnte durch die Prüfung der Verlegereife des Estrichs nicht festgestellt werden.
Überhaupt ist es nicht möglich, durch die Prüfung der Verlegereife festzustellen, ob in der Tiefe des Fußbodenaufbaus eine übermäßige Feuchtigkeit vorhanden ist. Denn die Prüfung der Verlegereife beschränkt sich auf den Estrich. Der Zustand der Schichten darunter, namentlich der Dämmung, wird dabei nicht erfasst. Das hat der Sachverständige O. ausgeführt (Stellungnahme vom 20.12.2013, Anlage BB 1, Bl. 18). Es folgt unmittelbar aus der Methode der Messung, die eine Probe nur des Estrichs betrifft.
3. Der Senat ist nicht davon überzeugt, dass der Estrich zur Zeit der Verlegung der Bodenbeläge zu feucht gewesen ist. Es verbleiben Zweifel an den entsprechenden Ausführungen des Sachverständigen K.. Beweisbelastet für eine zu hohe Feuchtigkeit des Estrichs als Ursache für das Schimmelwachstum im Fußbodenaufbau ist die Klägerin. Denn der Bauherr muss einen Baumangel beweisen, der einen Schluss auf ein Überwachungsverschulden des Architekten zulässt.
a) Der Sachverständige K. hat seine Befunde über das Gebäude etwa drei Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten erhoben. Eine positive Feststellung, dass seinerzeit die Feuchtigkeit im Estrich zu hoch gewesen sei, war nicht mehr möglich. Der Sachverständige hat vielmehr im Ausschlussverfahren andere mögliche Ursachen für die von ihm festgestellte Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau ausgeschlossen, weil er dann zu erwartende Begleiterscheinungen nicht vorgefunden habe, und die zu hohe Feuchtigkeit des Estrichs die einzige verbleibende mögliche Ursache bezeichnet (Gutachten vom 10.04.2010, S. 30 ff.). Indes sind nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht alle anderen Ursachen sicher auszuschließen.
aa) Der Sachverständige K. hat ausgeführt (Gutachten vom 10.04.2010, S. 32, 44 f.), es könne ausgeschlossen werden, dass Wischwasser in den Bodenaufbau eingedrungen sei. Er habe zwar zahlreiche Fehlstellen und Abrisse der Randversiegelungen des Fußbodenbelages vorgefunden, ein kontinuierliches Eindringen von Wasser in den Fußbodenaufbau über die Randfugen in der für die festgestellten Durchfeuchtungen notwendigen Menge würde jedoch zwangsläufig zu einer Durchfeuchtung der Fußpunktbereiche führen, die er nicht festgestellt habe. Im Obergeschoss sei zudem der Linoleumbelag einige Zentimeter an der Wand hochgeführt und es gebe nur geringe Fehlstellen, so dass dort Wasser nicht eindringen könne. In der Estrichscholle seien keine Rückstände des Reinigungsmittels festgestellt worden.
Der Sachverständige Z. hat dagegen angemerkt (Stellungnahme vom 28.11.2016, Anlage BB 4, S. 15 f.; Stellungnahme vom 05.09.2018, Anlage BB 7, S. 2 f.), nach seiner Erfahrung würden häufig mit Wasser verdünnte Reinigungsmittel in so großen Mengen aufgetragen, dass sie über offene Randfugen in den Fußbodenaufbau eindrängen. Es sei selten der Fall, dass das zu Schäden im Sockelbereich führe. Das Wasser breite sich im Fußbodenaufbau aus. Auch, wo Fugen nicht gerissen seien, könne es Flankenabrisse geben. Jedenfalls liege keine Innenraumabdichtung vor, die größeren Mengen Wassers standhalten könne. Die Reinigungsmittel müssten nicht zwingend feststellbar, sein, weil sie sich abgebaut haben könnten. Dass der vom Sachverständigen K. festgestellte Feuchtigkeitsgehalt im Obergeschoss geringer gewesen sei als im Erdgeschoss, könne eher damit erklärt werden, dass dort die Ränder des Fußbodenbelags anders ausgebildet gewesen seien, als mit einer Baufeuchte.
Diese Ausführungen lassen zumindest an den Ausführungen des Sachverständigen K. zweifeln. Der Sachverständige Z. ist wie der Sachverständige K. Sachverständiger für Schäden an Gebäuden. Er verfügt so ebenfalls über hinreichende Erfahrung mit Schadensbildern wie dem vorliegenden, um dessen Ursachen beurteilen zu können. Sein Erfahrungswissen hat kein geringeres Gewicht als das des Sachverständigen K..
Zudem ist die von dem Sachverständigen Z. gelieferte Erklärung plausibel. Es lässt sich leicht vorstellen, dass Feuchtigkeit, die sich im Fußbodenaufbau ausbreitet, schwer wieder austrocknet, während die Trocknung an den offenen Randfugen leichter ist. Das würde erklären, dass der Sachverständige K. weder eine Durchfeuchtung der Fußpunkte noch einen Schimmelbefall hinter der Fußleiste oder an der Tapete festgestellt hat.
Auch der Sachverständige K. geht davon aus, dass sich die Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau über lange Zeit halten kann, auch wenn er eine andere Ursache dafür annimmt. Dann muss die Feuchtigkeit aber nicht kontinuierlich bis kurz vor dem Zeitpunkt der Besichtigung durch den Sachverständigen K. eingedrungen sein, was um so eher erklären würde, dass die Fußpunkte der Wände schadensfrei waren.
Es kann so nicht ausgeschlossen werden, dass die von dem Sachverständigen K. im Fußbodenaufbau festgestellte Feuchtigkeit auch durch Wasser verursacht worden ist, dass durch die Randfugen eingesickert ist. Das kann auch im Obergeschoss der Fall gewesen sein, da auch dort die Fugen nicht vollständig dicht sind. Zudem hat der Sachverständige K. dort unvollständige oder gerissene Anschlussfugen an den Stahlzargen der Innentüren festgestellt (Gutachten vom 10.04.2010, S. 11). Auch dort kann Wasser eingedrungen sein.
bb) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beim Verlegen des Estrichs Feuchtigkeit in die Trennlage und die Dämmung eingedrungen ist.
Der Sachverständige O. hat darauf hingewiesen (Stellungnahme vom 20.12.2013, Anlage BB 1, S. 16 f.), dass die Trennschicht zwischen Dämmung und Estrich beim Verlegen des Estrichs unvermeidlich durchfeuchtet werde. Beim Verdichten könne freies Anmachwasser bis unter die Dämmschicht sickern. Der Sachverständige K. hat darauf erwidert (Gutachten vom 25.06.2016, S. 5) es gebe kein freies Anmachwasser, der Estrich werde erdfeucht verlegt. Dagegen gibt der Sachverständige Z. wiederum zu Bedenken (Stellungnahme vom 28.11.2016, Anlage BB 4, S. 14), das sei in der Regel zutreffend, der Sachverständige K. habe den Einbau aber nicht gesehen.
Es ist in der Tat nicht bekannt, in welchem Zustand der Estrich eingebaut worden ist. Es ist möglich, dass eine überschüssige Feuchtigkeit vorhanden war, die in den Fußbodenaufbau eindringen konnte. Soweit darin ein Fehler des Estrichlegers liegen sollte, musste er dem Beklagten nicht auffallen. Denn das Verlegen von Estrich ist eine handwerkliche Selbstverständlichkeit, die keiner besonderen Überwachung bedarf (OLG Rostock, Urteil vom 11.11.2008, 4 U 27/06, Rn. 124, 149 f.).
cc) Damit im Zusammenhang steht, dass der Sachverständige K. nicht vollständig zweifelsfrei erklärt hat, wie die Feuchtigkeit aus dem Estrich in den Fußbodenaufbau gelangt ist. Er hat im Termin vom 17.08.2018 angegeben, der Diffusionswiderstand der Fußbodenbeläge sei höher als derjenige des Bitumenpapiers zwischen Estrich und Dämmung. Die Dämmung weise Fugen auf, durch die sich die Feuchtigkeit dann weiter verbreiten könne, so dass deren Diffusionswiderstand nicht angesetzt werden müsse.
Der Sachverständige Z. tritt dem entgegen (Stellungnahme vom 28.11.2016, Anlage BB 4, S. 14 f.; Stellungnahme vom 05.09.2018, Anlage BB 7, S. 5 f.). Er meint, dass es näherer Feststellungen zu den Dampfdiffusionswiderstandswerten der einzelnen Baumaterialien und einer genauen Berechnung bedürfe. Da die Fugen zwischen den Dämmplatten in der Regel nicht übereinander lägen, müsse auch der Dampfdiffusionswiderstand der Dämmplatten selbst angesetzt werden. Es sei üblich, dass sich auch bei einer trockenen Estrichplatte durch die Baufeuchte aus umliegenden Bauteilen Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau bilde. Wegen des geringen Diffusionswiderstandes der Fußbodenbeläge trockne der Estrich in der Regel in zwei bis drei Jahren nach oben hin ab.
Diese Ausführungen werden durch die Ausführungen des Sachverständigen K. nicht widerlegt. Insbesondere ist es gut nachvollziehbar, dass auch die Dämmplatten der ungehinderten Ausbreitung des Wasserdampfs im Fußbodenaufbau entgegenstehen, weil keine durchgehenden Fugen vorhanden sind. Der Sachverständige K. hat aber Schimmel auch an der Unterseite der Dämmplatten festgestellt. Wie die dazu notwendige Feuchtigkeit dorthin gelangt ist, steht nicht fest.
dd) Es ist schließlich zu bedenken, dass die von dem Sachverständigen K. festgestellte Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau nicht eine einzige Ursache haben muss.
Es steht fest, dass im Estrich auch nach dem Erreichen der Verlegereife noch Feuchtigkeit vorhanden ist, die beim weiteren Austrocknen in die Umgebung abgegeben werden kann. Darauf hat der Sachverständige O. hingewiesen (Stellungnahme vom 20.12.2013, Anlage BB 1, S. 16 f., 19 f.). Der Sachverständige K. hat das grundsätzlich bestätigt (Gutachten vom 25.06.2016, S. 8 f.). Nach seinen Ausführungen stellt sich bei einem nach Verlegereife abgedeckten Estrich bei Erreichen der Ausgleichsfeuchte in der Umgebung eine Luftfeuchtigkeit von ca. 70 % ein, die Schimmelwachstum in der Regel noch nicht ermögliche. Allerdings hat er zuvor ausgeführt (Gutachten vom 10.04.2010, S. 20), dass Schimmelwachstum ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 % möglich sei und Bakterienwachstum ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 %.
In jedem Fall bedeuten die Ausführungen des Sachverständigen K., wenn man eine Ausbreitung der Feuchtigkeit aus dem Estrich in den Fußbodenaufbau annimmt, dass sich der überwiegende Teil der von ihm gemessenen Luftfeuchtigkeitswerte aus der unvermeidlichen Feuchtigkeit ergibt, die bereits bei einem verlegereifen Estrich zu erwarten ist. Es müssen durch andere Ursachen, wie eindringendes Wischwasser oder Anmachwasser, nur geringe zusätzliche Wassermengen in den Fußbodenaufbau eingebracht worden sein. Es ist so nicht notwendig, wie der Sachverständige K. meint (Gutachten vom 10.04.2010, S. 32), den Befund etwa allein mit eingedrungenem Wischwasser zu erklären.
b) Es gibt Zweifel daran, dass die von dem Sachverständigen K. festgestellten Feuchtigkeitswerte des Estrichs zutreffen.
Der Sachverständige K. hat seine Schlussfolgerung entscheidend darauf gestützt, dass seine Messungen noch drei Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten hohe Feuchtigkeitswerte ergeben hätten, in zwei Räumen sogar oberhalb der Verlegereife (Gutachten vom 10.04.2010, S. 34). Er ist, anders als die Zeugen V. und P., nach der Darrmethode vorgegangen, bei der die Estrichprobe getrocknet und die Gewichtsdifferenz durch das Austreiben von Feuchtigkeit dabei gemessen wird.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse der Messungen durch den verwendeten Schnellbinder verfälscht worden sind. Darauf hat der Sachverständige O. hingewiesen (Stellungnahme vom 20.12.2013, Anlage BB 1, S. 20). Der Sachverständige Z. hat dazu ausgeführt (Stellungnahme vom 28.11.2016, Anlage BB 4, S. 19, Stellungnahme vom 05.09.2018, Anlage BB 7, S. 6 f.), dass z. T. Feuchtigkeit durch Zusatzmittel kristallin gebunden und beim Darren zusätzlich ausgetrieben werde, so dass sich ein höherer Feuchtigkeitswert ergebe. Um das festzustellen, habe die Ausgleichsfeuchte bestimmt werden müssen, bei der es nicht mehr zur Abgabe von Feuchtigkeit komme.
Der Sachverständige K. hat diese Möglichkeit nicht widerlegt. Er hat in seinem Gutachten vom 25.06.2016 (S. 9, 13, 26) nur ausgeführt, um die Ausgleichsfeuchte gehe es nicht. Schnellbinder setzten in der Regel den Bedarf an Anmachwasser herab. Es gälten keine anderen Grenzwerte und seien keine abweichenden Ergebnisse der Messung zu erwarten. Wie es sich bei dem Gebäude der Klägerin verhalten hat, hat der Sachverständige jedoch nicht untersucht. Soweit er gemeint hat, die Trocknungskurve belege die Verwendung eines Schnellbinders nicht, ist das unerheblich, weil dessen Verwendung unstreitig ist. Im Termin vom 17.08.2018 hat der Sachverständige K. dagegen die Grundannahmen des Sachverständigen Z., dass sich bei kristallin gebundenem Wasser höhere Werte bei der Darrprobe ergäben, bestätigt.
Die Messergebnisse des Sachverständigen K. werden nicht durch die Messergebnisse des Sachverständigen V. belegt. Dieser hat mit der auch von den Zeugen V. und P. angewandten CM-Methode etwa zwei Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten Feuchtigkeitsgehalte von 2,4 % und 2,2 % ermittelt (Gutachten vom 29.11.2008, S. 7, Bl. 26 d. A., Gutachten vom 20.01.2009, S. 3, Bl. 40 d. A.). Diese Werte liegen aber nur geringfügig oberhalb des Wertes von 2 %, ab dem von einer Verlegereife auszugehen ist. Zudem kann nach dem oben Gesagten nicht ausgeschlossen werden, dass Wasser in den Fußbodenaufbau eingedrungen ist, das dann auch zu einer Rückfeuchtung des Estrichs geführt haben kann.
c) Die Schadensfreiheit der Fußbodenbeläge spricht eher dafür, dass die Verlegereife erreicht war. Die Fußbodenbeläge wiesen unstreitig zu keinem Zeitpunkt Anzeichen der Einwirkung erhöhter Feuchtigkeit auf. Es kommt hinzu, dass der Zeuge V. auch insoweit glaubhaft bekundet hat, er und der Zeuge P. hätten eine Spachtelmasse verwendet. Feuchtigkeit habe zum Abreißen und beim Schleifen zum Zusetzen des Schleifpapiers führen müssen, was nicht der Fall gewesen sei. Das zeigt, dass bereits in der Bauzeit keine Anzeichen erhöhter Feuchtigkeit vorhanden waren.
Der Senat verkennt nicht, dass nach den Ausführungen des Sachverständigen (Gutachten vom 10.04.2010, S. 51; Gutachten vom 17.02.2011, S. 5 ff.; Gutachten vom 25.06.2016, S. 7; Anhörung im Termin vom 17.08.2018) eine zu hohe Feuchtigkeit des Estrichs nicht zwingend zu einem Schaden der Bodenbeläge führen müsse. Insbesondere bei einer vollflächigen Verklebung müsse es nicht zu einer Verformung kommen. Die Haftkraft des Klebers sei stärker als die treibenden Kräfte. Auch ein feuchter Estrich könne noch ausreichend Feuchtigkeit aus dem Kleber aufnehmen, um eine Verbindung zu ermöglichen.
Dem steht entgegen, dass eine zu hohe Feuchtigkeit des Estrichs jedenfalls ein erheblicher Risikofaktor für die Bodenbeläge ist. Das ist der Grund dafür, dass eine Messung der Verlegereife durchgeführt wird. Es ist auffällig, dass auch das Parkett keine Verformung aufwies. Dem Senat sind aus seiner Spezialzuständigkeit für Bausachen zahlreiche Fälle bekannt, in denen eine fehlende Verlegereife innerhalb kurzer Zeit zu erheblichen Verformungen des Parketts führte. In einem Fall hielt zwar der Kleber, der Estrich wurde aber durch die Verformung des Parketts beschädigt.
Es ist dabei auch zu berücksichtigen, dass die Feuchtigkeit im Estrich zur Zeit der Verlegung der Bodenbeläge deutlich höher gewesen sein müsste als zur Zeit der Messungen durch den Sachverständigen K., weil in den dazwischenliegenden drei Jahren eine teilweise Austrocknung stattgefunden hätte. Der Sachverständige Z. hat darauf hingewiesen (Stellungnahme vom 28.11.2016, Anlage BB 4, S. 16; Stellungnahme vom 05.09.2018, Anlage BB 7, S. 7 f.), dass dann Schäden annähernd unvermeidbar gewesen seien. Das ist plausibel, gerade angesichts der Erfahrungen des Senats aus anderen Fällen.
Der Sachverständige K. hat im Termin vom 17.08.2018 bestätigt, dass der Feuchtigkeitsgehalt zur Zeit der Verlegung der Bodenbeläge höher gewesen sein muss, konnte aber nicht genau angeben, von welcher Änderung auszugehen ist. Er schätzte eine Differenz von 0,5 Prozentpunkten bis 1 Prozentpunkt und meinte, dass dann nicht zwingend Schäden an den Belägen auftreten müssten. Diese Angaben sind zu ungenau, um die Indizwirkung der schadensfreien Bodenbeläge auszuräumen.
d) Nicht zuletzt stehen die Aussagen der Zeugen V. und P., nach denen die Verlegereife erreicht gewesen sei, den Schlussfolgerungen des Sachverständigen K. entgegen. Die durch die Aussagen veranlassten Zweifel sind nicht ausgeräumt.
Der Sachverständige hat seine Schlussfolgerungen nach Konfrontation mit den Aussagen aufrechterhalten. Er hat seiner Schlussfolgerung mit entscheidend zugrunde gelegt, dass eine fehlerfreie Messung der Verlegereife nicht dokumentiert sei (Gutachten vom 10.04.2010, S. 40 f.; Gutachten vom 25.06.2016, S. 12). Er hat gemeint, die Proben seien durch die Zeugen ggf. von der Oberfläche des Estrichs entnommen worden, wo die Trocknung weiter fortgeschritten war.
Wie oben dargelegt, sind die Aussagen der Zeugen V. und P. glaubhaft. Sie sind nicht deswegen irrelevant, weil ein Protokoll der Messungen nicht vorliegt. Wie oben dargelegt, würden sich relevante Fehler der Messungen aus dem Protokoll nicht ergeben. Zudem hat der Sachverständige keine Fehler der Zeugen bei der Messung aufzeigen können, die dazu geführt hätten, dass ein zu niedriger Wert angezeigt worden wäre. Insbesondere hat sich nicht bestätigt, dass die Proben von der Oberfläche des Estrichs entnommen worden sind.
Die Aussagen der Zeugen V. und P. und die Schlussfolgerungen des Sachverständigen stehen einander so unvereinbar gegenüber. Das lässt zumindest daran zweifeln, ob die Baufeuchte die – einzige – Ursache für das von dem Sachverständigen K. festgestellte Schimmelwachstum war.
4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 10, 709, 711 ZPO.
Die Zulassung der Revision ist nicht angezeigt, weil die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert (§ 543 Abs. 2 ZPO). Es handelt sich um eine Entscheidung im Einzelfall. Die entscheidungserheblichen Rechtsfragen sind geklärt.