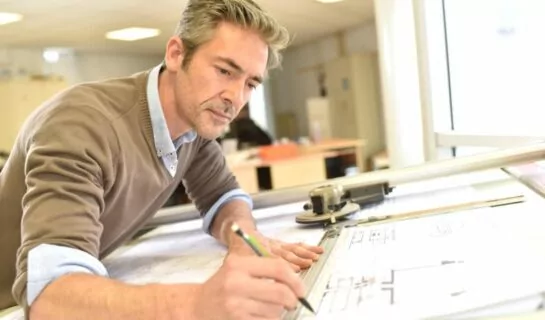Einsicht in Nachbargrundstück: Gericht lehnt Beschwerde gegen Balkonanbau ab
In einem aktuellen Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) wurde die Beschwerde einer Antragstellerin zurückgewiesen, die sich gegen die Baugenehmigung eines Balkons am Nachbargebäude richtete. Das Gericht stellte fest, dass trotz der möglichen Einsicht in das Grundstück der Antragstellerin keine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme vorliegt.
Direkt zum Urteil Az: 10 B 1778/21 springen.
Übersicht
Hintergrund des Rechtsstreits
Die Antragstellerin hatte die aufschiebende Wirkung ihrer Klage gegen die Baugenehmigung des Anbaus eines Balkons an das Wohngebäude auf dem Nachbargrundstück beantragt. Das Verwaltungsgericht hatte den Antrag abgelehnt, da es der Auffassung war, dass die Baugenehmigung wahrscheinlich nicht gegen nachbarschützende Vorschriften des öffentlichen Baurechts verstoße. Die Antragstellerin legte Beschwerde ein und argumentierte, das Vorhaben wahre trotz Einhaltung der abstandsflächenrechtlichen Vorschriften nicht den erforderlichen Sozialabstand.
Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts
Das OVG NRW bestätigte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts und wies die Beschwerde als unbegründet zurück. Das Gericht führte aus, dass die Ausrichtung von Fenstern, Balkonen oder Terrassen eines neuen Gebäudes bzw. Gebäudeteils, die den Blick auf ein Nachbargrundstück ermöglichen, nicht per se rücksichtslos sei. Es sei in bebauten Gebieten üblich, dass infolge einer solchen Bebauung Einsichtsmöglichkeiten entstehen.
Nach ständiger Rechtsprechung der Bausenate des Oberverwaltungsgerichts sei dies regelmäßig hinzunehmen. Ein Anspruch auf Schutz vor fremden Blicken auf Teilen der Freiflächen des eigenen Grundstücks lasse sich nicht aus einem Recht auf Privatsphäre herleiten. Ob es dem Eigentümer oder Nutzer eines Grundstücks möglich wäre, Teile des eigenen Grundstücks etwa durch Anpflanzungen oder sonstige Sichtschutzmaßnahmen den unerwünschten Blicken Dritter zu entziehen, sei nicht ausschlaggebend.
Fazit und Konsequenzen des Urteils
Das Urteil des OVG NRW verdeutlicht, dass eine Bebauung des Nachbargrundstücks, die Einsicht in das eigene Grundstück ermöglicht, nicht automatisch als rücksichtslos oder rechtswidrig angesehen wird. Eigentümer oder Nutzer von Grundstücken können nicht erwarten, dass ihnen auf den Freiflächen ihres Grundstücks ein den Blicken Dritter entzogener Bereich verbleibt. In bebauten Gebieten müssen sie regelmäßig hinnehmen, dass durch neue Bebauungen Einsichtsmöglichkeiten entstehen, solange die abstandsflächenrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Handlungsempfehlung bei ähnlichen Problemen
Sollten Sie ebenfalls von einem Bauvorhaben auf einem Nachbargrundstück betroffen sein und Unsicherheiten bezüglich der Zulässigkeit und der Einhaltung von nachbarschützenden Vorschriften haben, empfiehlt es sich, rechtlichen Rat einzuholen. Eine fundierte Ersteinschätzung durch unsere Experten kann Ihnen Klarheit verschaffen und möglicherweise helfen, unnötige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden oder bei berechtigten Einwänden rechtzeitig tätig zu werden.
Das vorliegende Urteil
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen – Az.: 10 B 1778/21 – Beschluss vom 17.01.2022
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen.
Der Streitwert wird auch für das Beschwerdeverfahren auf 3.750 Euro festgesetzt.
Gründe
Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Das Verwaltungsgericht hat den Antrag der Antragstellerin, die aufschiebende Wirkung ihrer Klage gegen die den Beigeladenen von der Antragsgegnerin am 28. Juni 2021 erteilte Baugenehmigung für den Anbau eines Balkons an das Wohngebäude auf dem Grundstück L. Straße 12 in T. (Gemarkung P., Flur 76, Flurstücke 100 und 319) anzuordnen (im Folgenden: Vorhaben), mit der Begründung abgelehnt, die nach den §§ 80a Abs. 3, 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO vorzunehmende Interessenabwägung falle zu Lasten der Antragstellerin aus, weil die Baugenehmigung wahrscheinlich nicht gegen Nachbarschutz vermittelnde Vorschriften des öffentlichen Baurechts verstoße. Eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme zum Nachteil der Antragstellerin liege nicht vor. Zwar könne von dem Vorhaben aus in deren Wohn- und Schlafzimmer sowie in deren Garten geblickt werden. Die hiermit einhergehenden Belästigungen gingen jedoch nicht über das hinaus, was in innerstädtischen Bereichen grundsätzlich hinzunehmen sei.
Das Beschwerdevorbringen, auf dessen Prüfung der Senat gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, rechtfertigt keine andere Entscheidung.
Die Antragstellerin macht weiterhin ohne Erfolg geltend, das Vorhaben wahre trotz Einhaltung der abstandsflächenrechtlichen Vorschriften nicht den erforderlichen Sozialabstand.
Lassen Fenster, Balkone oder Terrassen eines neuen Gebäudes beziehungsweise Gebäudeteils den Blick auf ein Nachbargrundstück zu, ist deren Ausrichtung, auch wenn der Blick von dort in einen Bereich des Nachbargrundstücks fallen kann, der nach dem Willen des Nachbarn in besonderer Weise dazu dienen soll, sich ins Private zurückzuziehen, ungestört auszuruhen und zu entspannen, nicht aus sich heraus rücksichtslos. Es ist in bebauten Gebieten üblich, dass infolge einer solchen Bebauung erstmals oder zusätzlich Einsichtsmöglichkeiten entstehen. Nach ständiger Rechtsprechung der Bausenate des Oberverwaltungsgerichts ist dies regelmäßig hinzunehmen. Der Eigentümer oder Nutzer eines Grundstücks kann nicht für sich beanspruchen, dass ihm auf den Freiflächen seines Grundstücks ein den Blicken Dritter entzogener Bereich verbleibt. Ein im Bauplanungsrecht wurzelnder Anspruch, zumindest auf einem Teil der Freiflächen des eigenen Grundstücks vor fremden Blicken geschützt zu sein, lässt sich auch nicht aus einem Recht auf Privatsphäre herleiten. Dass derjenige, der die eigenen vier Wände verlässt, dabei gesehen und sogar beobachtet werden kann, liegt in der Natur der Sache. Inwieweit es ihm möglich wäre, Teile des eigenen Grundstücks etwa durch Anpflanzungen oder sonstige Sichtschutzmaßnahmen den unerwünschten Blicken Dritter zu entziehen, ist nicht ausschlaggebend.
Vgl. nur OVG NRW, Urteil vom 8. April 2020 – 10 A 352/19 -, juris, Rn. 32 ff., mit weiteren Nachweisen.
Ausgehend hiervon ist das Vorhaben allein wegen des Umstandes, dass von dort aus der Garten der Antragstellerin vollständig und ihre Terrasse weitgehend eingesehen werden können, ihr gegenüber nicht rücksichtslos. Darauf, ob von dem Wohnhaus der Antragstellerin, insbesondere von ihrer Dachterrasse aus, in vergleichbarer Weise auf die auf dem Grundstück der Beigeladenen etwaig vorhandenen sensiblen Bereiche der oben beschriebenen Art geschaut werden kann, kommt es nicht entscheidend an. Vor den von ihr befürchteten Einblicken in gartenseitige Zimmer ihres Wohnhauses kann sich die Antragstellerin, was ihr ohne Weiteres zuzumuten ist, durch das Anbringen von Vorhängen oder Ähnlichem schützen, wenn sie sich gestört fühlt. Angesichts der tatsächlichen Entfernung zwischen ihrem Wohnhaus mit der Terrasse sowie der Dachterrasse und dem Vorhaben ist auch nicht anzunehmen, dass hier bei einer Verwirklichung des Vorhabens – im übertragenen Sinne – jegliche Distanz verloren ginge. Die Antragstellerin räumt überdies selbst ein, dass es die Abstandsflächenvorschriften wegen des jeweils besonderen Zuschnitts ihres Grundstücks und des Grundstücks der Beigeladenen zulassen, dass die nordwestliche Ecke des Vorhabens unmittelbar bis an die an dieser Stelle verspringende gemeinsame Grundstücksgrenze reicht. Mit einer entsprechenden baulichen Ausnutzung des Nachbargrundstücks musste die Antragstellerin dementsprechend auch rechnen.
Aus ihrem Vorbringen zu einer zivilrechtlichen Vereinbarung, derzufolge der Rechtsvorgänger der Beigeladenen einen an der gemeinsamen Grundstücksgrenze verlaufenden Grundstücksstreifen ihrem Rechtsvorgänger zur gärtnerischen Nutzung überlassen hat, folgt keine andere rechtliche Bewertung, wie sich schon aus § 74 Abs. 4 BauO NRW ergibt, wonach eine Baugenehmigung unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt wird.
Soweit die Antragstellerin in ihrer Beschwerdebegründung pauschal auf ihren Vortrag im erstinstanzlichen Verfahren verweist, genügt dies von vornherein nicht den an die Darlegung der Beschwerdegründe zu stellenden Anforderungen.
Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 154 Abs. 2, 162 Abs. 3 VwGO.
Die Streitwertfestsetzung beruht auf den §§ 47 Abs. 1 und 3, 52 Abs. 1, 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG.
Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, §§ 68 Abs. 1 Satz 5, 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).