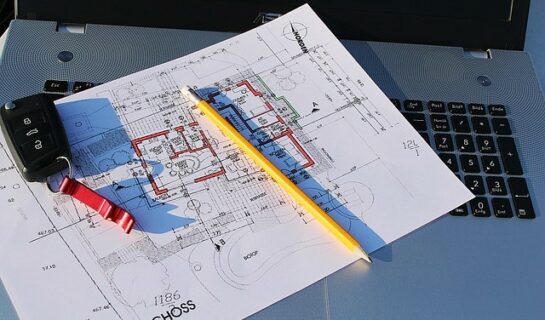Kosten bei Wasserschäden: Baurechtliche Ansprüche im Detail
Das Landgericht Mühlhausen hat im Fall eines umfangreichen Wasserschadens in drei Mehrfamilienhäusern entschieden, dass der Beklagte, der Insolvenzverwalter der verantwortlichen Subunternehmerin, der Klägerin über 472.000 € Schadensersatz zahlen muss. Dies beinhaltet auch die Erstattung von Personalkosten für die Schadensermittlung und -abwicklung, was aufzeigt, dass bei der Schadensregulierung nicht nur direkte Reparaturkosten, sondern auch indirekte Kosten wie Personalkosten und rechtliche Beratung Berücksichtigung finden können.
Weiter zum vorliegenden Urteil Az.: 6 O 247/17 >>>
✔ Das Wichtigste in Kürze
Die zentralen Punkte aus dem Urteil:
- Verurteilung des Beklagten: Der Beklagte muss 472.293,86 € plus Zinsen an die Klägerin zahlen.
- Erstattung von Personalkosten: Im Urteil wird anerkannt, dass Personalkosten zur Schadensermittlung erstattungsfähig sind.
- Umfangreiche Schadensermittlung: Die Klägerin musste für umfangreiche Leckageortungen und Schadensermittlungen aufkommen.
- Kausalität der Wasserschäden: Die Wasserschäden wurden durch fehlerhaft verpresste Fittinge verursacht und zogen umfangreiche Folgeschäden nach sich.
- Beweislast und Beweisaufnahme: Die Beweisaufnahme bestätigte die Aussagen der Klägerin bezüglich der Ursache und des Umfangs der Schäden.
- Ablehnung des Feststellungsantrags: Ein Teil der Klage bezüglich der Feststellung künftiger Schäden wurde abgelehnt.
- Rechtsanwaltskosten: Die Kosten für die rechtliche Beratung wurden als Teil des Schadens anerkannt.
- Teilweise Abweisung der Klage: Ein Teil der Klage wurde abgewiesen, da die Klägerin ihre Forderungen nicht vollständig dargelegt hatte.
Übersicht
- Kosten bei Wasserschäden: Baurechtliche Ansprüche im Detail
- ✔ Das Wichtigste in Kürze
- Wasserschäden und Baurecht: Die Herausforderungen der Schadensregulierung
- Umfangreiche Wasserschäden und die Frage der Erstattungsfähigkeit
- Die Herausforderung der Schadenslokalisierung und -bewertung
- Detaillierte Beweisaufnahme und Urteilsfindung
- Klärung der Erstattungsfähigkeit von Personalkosten
- Urteil und Ausblick
- ✔ Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Das vorliegende Urteil
Wasserschäden und Baurecht: Die Herausforderungen der Schadensregulierung

Im Baurecht treffen oft komplexe Sachverhalte aufeinander, besonders wenn es um Schäden an Immobilien geht. Ein zentrales Thema in diesem Bereich ist die Erstattungsfähigkeit von Kosten, die im Zusammenhang mit der Ermittlung und Behebung von Wasserschäden entstehen. Hierbei geht es nicht nur um die offensichtlichen Reparaturkosten, sondern auch um weitere, indirekte Ausgaben, wie Personalkosten für die Schadensermittlung und -bearbeitung. Diese Kosten können einen erheblichen Umfang annehmen und sind daher oft Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen.
In Fällen, in denen es um umfangreiche Wasserschäden in Gebäuden geht, stellen sich Fragen zur Haftung und zu den Umfängen der Schadensregulierung. Dabei ist nicht nur die Klärung der unmittelbaren Ursachen von Bedeutung, sondern auch die Bewertung der Angemessenheit und Notwendigkeit der in Anspruch genommenen Maßnahmen. Der nachfolgende Text beleuchtet einen konkreten Fall, in dem diese Aspekte im Kontext des Baurechts eine Rolle spielen und zeigt auf, wie Gerichte mit der Komplexität und den Herausforderungen der Schadensregulierung umgehen. Tauchen Sie ein in die Welt des Baurechts, wo jede Entscheidung weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen kann.
Umfangreiche Wasserschäden und die Frage der Erstattungsfähigkeit
In einem bemerkenswerten Fall vor dem Landgericht Mühlhausen, Az.: 6 O 247/17, standen Schadensersatzansprüche aus umfangreichen Wasserschäden in drei Mehrfamilienhäusern im Fokus. Die Klägerin, eine Generalunternehmerin, errichtete diese Gebäude in der B-Straße in W. für die C GmbH als Bauträgerin. Der Beklagte, der Insolvenzverwalter der für den Rohbau zuständigen Subunternehmerin A GmbH & Co. KG, wurde wegen diverser Wasserschäden, die nachweislich bereits seit 2011 auftraten, zur Rechenschaft gezogen. Die Klägerin forderte umfassenden Schadenersatz, der neben den direkten Sanierungskosten auch Mehrkosten wie rechtliche Beratung, Sachverständigenhonorare und insbesondere Personalkosten umfasste.
Die Herausforderung der Schadenslokalisierung und -bewertung
Die Komplexität des Falles lag in der Natur der Schäden. Die Klägerin argumentierte, dass die Wasserschäden im gesamten Haus auf fehlerhaft verpresste Fittinge zurückzuführen waren, was die Lokalisierung der Schäden erschwerte. Die Wasserschäden manifestierten sich in verschiedenen Wohnungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, was die Schadensermittlung und -bewertung außerordentlich komplizierte. Die Klägerin wurde mit Ansprüchen seitens der Gebäudeversicherung, der Bauträgerin sowie der Eigentümer und Mieter konfrontiert, die sich in hunderte Einzelschadenspositionen aufteilten.
Detaillierte Beweisaufnahme und Urteilsfindung
Das Gericht führte eine umfassende Beweisaufnahme durch, wobei Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten eine zentrale Rolle spielten. Die Beweisaufnahme bestätigte, dass die Schäden in den betroffenen Wohnungen tatsächlich auf die mangelhafte Ausführung der Rohrgewerke zurückzuführen waren. Besonders herausfordernd war die Bewertung der Angemessenheit der geltend gemachten Schadensposten. Der Beklagte hatte argumentiert, dass ein Sachverständigengutachten zur Überprüfung der Erforderlichkeit und Angemessenheit der geltend gemachten Schadensposten notwendig gewesen wäre. Das Gericht stellte jedoch fest, dass die geltend gemachten Kosten für die Schadensermittlung, Sanierung, sowie die Kosten der rechtlichen Beratung und der Personalkosten tatsächlich erforderlich und angemessen waren.
Klärung der Erstattungsfähigkeit von Personalkosten
Ein wesentlicher Diskussionspunkt war die Erstattungsfähigkeit der Personalkosten. Die Klägerin argumentierte, dass die Schadensabwicklung außerordentlich umfangreich gewesen sei und umfangreiche Personaleinsätze erforderte. Das Gericht stellte fest, dass Personalkosten grundsätzlich nicht erstattungsfähig sind, es sei denn, sie überschreiten die üblichen Verwaltungstätigkeiten erheblich. Im vorliegenden Fall wurde entschieden, dass die Personalkosten der Klägerin aufgrund des erheblichen Umfangs und der Komplexität der Schadensabwicklung tatsächlich ersatzfähig sind.
Urteil und Ausblick
Letztendlich wurde der Beklagte dazu verurteilt, der Klägerin 472.293,86 € zuzüglich Zinsen zu zahlen, beschränkt auf die Leistung aus der Versicherungsforderung des Haftpflichtversicherers der A GmbH & Co. KG. Dieses Urteil setzt ein bedeutendes Präzedenz für die Erstattungsfähigkeit von Personalkosten in komplexen Schadensfällen und unterstreicht die Bedeutung detaillierter Beweisaufnahme und umfassender Sachverständigengutachten in baurechtlichen Streitigkeiten. Es zeigt auf, dass im Baurecht, insbesondere bei der Ermittlung und Bewertung von Schäden, eine sorgfältige und umfassende Herangehensweise entscheidend ist, um gerechte Urteile zu ermöglichen.
✔ Wichtige Begriffe kurz erklärt
Inwiefern sind Personalkosten in der Schadensermittlung erstattungsfähig?
Personalkosten können in der Schadensermittlung erstattungsfähig sein, allerdings hängt dies von verschiedenen Faktoren ab.
Zum einen sind Personalkosten erstattungsfähig, wenn das Personal direkt beim Zuwendungsempfänger nach nationalem Recht angestellt ist, unter dessen alleiniger Aufsicht steht und in Verantwortung des Zuwendungsempfängers tätig ist. Die Vergütung des Personals muss den üblichen Praktiken des Zuwendungsempfängers entsprechen. Abrechnungsfähig ist der Bruttolohn inklusive der Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger im Gehalt enthaltenen gesetzlichen Kosten.
Zum anderen können Personalkosten auch als ersparte Kosten in die Schadensermittlung einbezogen werden. Dies betrifft auftragsspezifische Personalkosten, die bei der Beschaffung von Material anfallen.
In bestimmten Fällen, wie beispielsweise bei Pflichtverletzungen, kann der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz seiner Aufwendungen in bestimmtem Umfang fordern. Hierbei kann es auch um Personalkosten gehen, die im Rahmen von zivil- und arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten entstanden sind.
Allerdings gibt es auch Fälle, in denen Personalkosten nicht erstattungsfähig sind. So hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass die von der Beklagten berücksichtigten Personalkosten als Verzugsschaden nicht erstattungsfähig sind.
Die genaue Erstattungsfähigkeit von Personalkosten in der Schadensermittlung hängt also stark vom Einzelfall und den spezifischen Umständen ab.
Das vorliegende Urteil
LG Mühlhausen – Az.: 6 O 247/17 – Urteil vom 14.04.2023
I. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 472.293,86 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB seit dem 20.06.2017 zu zahlen, beschränkt auf die Leistung aus der Versicherungsforderung des Haftpflichtversicherers der A GmbH & Co. KG.
II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte zu 88,33 % und die Klägerin zu 11,67 %.
IV. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche aus einem Wasserschaden in drei Mehrfamilienhäusern.
Die Klägerin errichtete als Generalunternehmerin drei Mehrfamilienhäuser in der B-straße 13/13a/13b in W. für die C GmbH als Bauträgerin. Der Beklagte wird in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter der Subunternehmerin A GmbH & Co. KG in Anspruch genommen. Die Subunternehmerin war verantwortlich für den Ausbau der Rohrgewerke in den im Jahr 2011 errichteten Neubauten. Unstreitig trat bereits am 16.11.2011 in den Wohnungen 4 und 10 ein Wasserschaden auf, den die D Versicherungs-AG als Versicherer der A GmbH & Co KG vollständig reguliert hat. Nach der Abnahme Anfang 2012 zeigten sich im April die ersten Wasserschäden mit Schimmelbildung in den Wohnungen 4 und 12 (Eigentümer X, Mieter Ehepaar Y), für die die Klägerin einen Gesamtschaden in Höhe von 215.278,00 € geltend macht. Am 17.05.2012 bzw. 21.05.2012 zeigten sich weitere Wasserschäden in den Wohnungen 13 und 21, für die die Klägerin einen Schadensersatz in Höhe von 20.645,36 € fordert. In Wohnung 10 wurden dann am 11.09.2012 weitere Schäden festgestellt, deren Kosten die Klägerin mit 74.734,14 € beziffert. Ferner fordert die Klägerin allgemeine Mehrkosten in Höhe von 171.943,70 €, die sich im Wesentlichen aus Kosten der rechtlichen Beratung, Kosten für diverse Sachverständige und Personalkosten zusammensetzen zuzüglich restlicher Kosten für eine Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 2.611,53 €.
Die Klägerin behauptet — was der Beklagte insoweit mit Nichtwissen bestritten hat —, Ursache der Wasserschäden seien fehlerhaft verpresste Fittinge gewesen, sodass es im ganzen Haus zu Wasserschäden gekommen sei. Die diversen Quellen des Wassers seien teilweise schwer auffindbar gewesen, da es sich zum einen um kleinste Undichtigkeiten gehandelt habe und zum anderen die Wohnungen durch Schächte und gemeinsame Wände miteinander verbunden seien, sodass der Schaden in der einen Wohnung sichtbar geworden sei, die Schadensursache jedoch in einer anderen Wohnung gelegen habe. Die Klägerin meint, man könne deshalb auch nicht von mehreren einzelnen Schadensereignissen sprechen, wie dies im Versicherungsrecht üblich sei, sondern müsse das Ganze als eine zusammenhängende Schadensursache begreifen, deren konkrete Schäden sich in Form von durchnässten Wänden und Schimmelbildung diffus und sukzessive gezeigt hätten. Sie sei aufgrund des Wasserschadens von der Gebäudeversicherung, der Bauträgerin, den Eigentümern und Mietern der Wohnungen mit diversen Ansprüchen, aufgespalten in hunderte Einzelschadenspositionen, in Anspruch genommen worden. Insoweit wird auf die Aufschlüsselung der Schadenspositionen in der Klageschrift vom 02.05.2017, Blatt 1 ff. der Akte Bezug genommen. Zusammenfassend seien ihr infolge des Wasserschadens Kosten für die Leckageortung, die Trocknung oder gar Sanierung der betroffenen Wohnungen, teilweise durch den vollständigen Rückbau, Mietausfälle, Kosten für Ersatzunterkünfte bis zu einem Jahr, Umzugskosten sowie Sachverständigenkosten entstanden. Sie ist der Auffassung, dass zu ihren Gunsten die Rechtsprechung zum Prognoserisiko Anwendung finde. Ferner meint die Klägerin, dass ihr auch die entstandenen Rechtsanwaltskosten sowie Personalkosten zu erstatten wären, da die Schadensabwicklung außerordentlich umfangreich gewesen sei.
Die Klägerin beantragt: Den Beklagten zu verurteilen, an sie 534.702,27 EUR nebst Zinsen i.H.v. 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, beschränkt auf die Leistung aus der Versicherungsforderung des Haftpflichtversicherers der A GmbH & Co. KG;
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, sämtliche weiteren Schäden, welche infolge von mangelhaft verpressten Rohrverbindungen in dem Objekt C-straße entstehen oder entstanden sind, zu ersetzen, ebenfalls beschränkt auf die Leistung aus der Versicherungsforderung des Haftpflichtversicherers der A GmbH & Co. KG.
Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
Der Beklagte behauptet, hinsichtlich der bereits regulierten Schäden aufgrund des Wasserschadens vom 16.12.2011 erfolge eine doppelte Inanspruchnahme, da die Wohnungen 4 und 10 bereits saniert worden seien. Der Beklagte ist der Auffassung, dass ein Sachverständigengutachten hinsichtlich der Schadenshöhe, nämlich insbesondere zur Erforderlichkeit und Angemessenheit der geltend gemachten Schadensposten hätte eingeholt werden müssen. Er meint ferner, die Kosten der rechtlichen Beratung seien nur auf Basis des RVG ersatzfähig. Personalkosten könne die Klägerin grundsätzlich nicht vom Beklagten verlangen, da diese nach der Rechtsprechung zur Mühewaltung gehören würden. Die Klägerin könne auch nicht die Kosten für die diversen Sachverständigen ersetzt verlangen. Hinsichtlich der Einzelheiten der bestrittenen Einzelschadenspositionen wird insbesondere auf die Klageerwiderung vom 18. August 2017, Blatt 65 ff. der Akten Bezug genommen.
Die Klageschrift ist dem Beklagten am 19.06.2017 zugestellt worden. Nachdem das Oberlandesgericht Jena das Urteil des Landgerichts Mühlhausen wegen Verstoßes gegen den Unmittelbarkeitsgrundsatz in der Berufungsinstanz aufgehoben und zurückverwiesen hat, hat das Landgericht Mühlhausen durch Vernehmung der Zeugen (…) Beweis erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlungen vom 23.09.2022 und 10.03.2023, Blatt 583 ff. und 723 ff. der Akte Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist teilweise zulässig und hinsichtlich des zulässigen Teils überwiegend begründet.
I.
Der Beklagte ist als Insolvenzverwalter der in Anspruch genommenen A GmbH & Co. KG als Partei kraft Amtes prozessführungsbefugt (§ 80 InsO, § 51 Abs. 1 ZPO).
Die Klage ist hinsichtlich des Feststellungsantrags unzulässig, weil die Klägerin das nach § 256 ZPO erforderliche rechtliche Interesse an der Feststellung des Rechtsverhältnisses nicht dargetan hat. Ein rechtliches Interesse an der Feststellung einer Ersatzpflicht für künftige Schäden ist zu bejahen, wenn die Möglichkeit besteht, dass solche Schäden eintreten. Für künftige Folgen eines bereits eingetretenen Werkmangels hat der BGH entschieden, dass grundsätzlich eine hinreichende Schadenswahrscheinlichkeit zumindest dann vorliegt, wenn es an anderen Stellen desselben Bauwerks bereits zu vergleichbaren Schadensbildern gekommen ist (BGH, NJW-RR 2010, 750, Rn. 12). Die Klägerin hat jedoch vorliegend kein Feststellungsinteresse, weil die Abnahme der Werkleistung am 10.01.2012 erfolgt ist und damit die Verjährungsfrist für Mängel aus dem Werkvertrag, selbst für Baugewerke, bereits abgelaufen ist und eine Inanspruchnahme der Klägerin durch die Werkunternehmerin nicht mehr möglich ist.
II.
1. Die Klägerin hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung in Höhe von 472.293,86 € aus §§ 631 Abs. 1, 633, 634 Nr. 4 BGB.
a)
aa) Zwischen der Klägerin und der Insolvenzschuldnerin bestand ein wirksamer Werkvertrag im Sinne des § 631 Abs. 1 BGB über den Ausbau der Rohrgewerke. Die Klägerin hat das Werk der Insolvenzschuldnerin am 10.01.2012 abgenommen.
bb) Die Insolvenzschuldnerin hat das Werk mangelhaft ausgeführt, indem die Fittinge nicht richtig verpresst wurden, was kausal zum Wasserschaden in den einzelnen Wohnungen führte.
(1) Der Vortrag der Klägerin hinsichtlich der Schäden in den Wohnungen 4 und 10, die bereits vom ersten Wasserschaden aus November 2011 betroffen waren, ist schlüssig. Soweit das Oberlandesgericht in seinem Hinweis in der Terminsverfügung vom 14.04.2021 noch der Auffassung war, dass der Schaden hinsichtlich der (erneuten) Schäden in den Wohnungen 4 und 10 nicht schlüssig vorgetragen worden sein dürfte, hat es im Urteil die Auffassung vertreten, dass die Klägerin ausreichend zur Schadensentstehung vorgetragen habe (vgl. Pkt. 3, Blatt 522 der Akte). Die Klägerin hat substantiiert vorgetragen und begründet, dass es zu erneuten Schäden und Sanierungen in den bereits vom Wasserschaden vor Abnahme betroffenen Wohnungen kam, weil die Wasserschäden wohnungsübergreifend verursacht wurden, sodass bei diversen Schadensquellen das Wasser aus jeder Richtung in nebeneinander/darunter liegenden Wohnungen eindringen konnte und damit mehrfach Schäden in denselben Wohnungen verursachen kann.
(2) Zugunsten der Klägerin streitet hinsichtlich der haftungsbegründenden Kausalität kein Beweis des ersten Anscheins. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs greift der Beweis des ersten Anscheins bei typischen Geschehensabläufen — auch bei Werkverträgen —, in denen ein bestimmter Tatbestand nach der Lebenserfahrung auf eine bestimmte Ursache für den Eintritt eines bestimmten Erfolges hinweist (BGH, Urt. v. 10.04.2014, VII ZR 254/13, NZBau 2014, 496, m.w.N.). Für die Anwendung eines Anscheinsbeweises müssen die Anknüpfungstatsachen unstreitig oder bewiesen sein. Im vorliegenden Fall ist es zwischen den Parteien unstreitig, dass die Wohnungen 4 und 10 nach dem ersten Wasserschaden durch Drittfirmen renoviert wurden, sodass aufgrund des Dazwischentretens Dritter ein Anscheinsbeweis nicht in Betracht kommt.
Dies ist jedoch unschädlich, da die Kammer nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon überzeugt ist, dass sich in der Wohnung 4 am 12.04.2012 und in der Wohnung 10 am 11.09.2012 erneut Wasserschäden gezeigt haben, die durch die mangelhaft ausgeführten Arbeiten der Insolvenzschuldnerin verursacht wurden.
Der Zeuge H hat bekundet, dass die mangelhaft verpressten Fittinge für die Wasserschäden im ganzen Haus schadensbegründend gewesen sind. Er konnte aus der Erinnerung erläutern, wie die Klägerin mithilfe von Leckageortungsfirmen die Löcher in den Rohrgewerken der Mehrfamilienhäuser ausfindig gemacht hat. Er konnte den Vortrag der Klägerin, warum es zu erneuten Wasserschäden in den Wohnungen 4 und 10 gekommen ist, für die Kammer nachvollziehbar bestätigen. Die Aussage des Zeugen war glaubhaft. Er konnte sich bereits in der freien Schilderung zu Beginn der Aussage und ohne weiteren Vorhalt der Anlagen an Namen von Sachverständigen, von Sanierungs- und Leckageortungsfirmen und von Eigentümern/Mietern der Mehrfamilienhäuser erinnern. Er bekundete sogar, wenn ihm ein Eigentümer aufgrund besonderer Verbissenheit und Unversöhnlichkeit noch in Erinnerung war. Dies lässt zum einen darauf schließen, dass er diese Situation tatsächlich selbst so erlebt hat und zum anderen, ist diese Bekundung ein nebensächliches Detail, das mit den für die Klägerin zu beweisenden Tatsachen nichts zu tun hat und die Aussage für die Kammer insoweit glaubhaft machen. Seine Schilderungen waren widerspruchsfrei und auch in der Erklärung der Abläufe der Sanierungen detailliert. Einen Strukturbruch im Aussageverhalten des Zeugen konnte die Kammer nicht feststellen. Der Zeuge konnte auch auf Nachfragen der Kammer rasch und frei antworten. Erinnerungslücken räumte der Zeuge ein.
(3) Soweit der Beklagte die gesamte Schadensentstehung mit Nichtwissen bestreitet ist dieses unzulässig. Gemäß § 138 Abs. 4 ZPO ist das Bestreiten mit Nichtwissen nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind. Zwar war er Ausbau der Rohrgewerke und damit auch ein mangelbehafteter Ausbau nicht Gegenstand der eigenen Handlung oder Wahrnehmung des Beklagten als Insolvenzverwalter, jedoch war es ihm zuzumuten Erkundigungen einzuholen und sich gegebenenfalls über die erfolglos gebliebenen Erkundigungen zu erklären (so auch OLG Jena mit Urteil vom 27.05.2021 zum hiesigen Verfahren, Blatt 516 ff. (520) der Akte). Auf die Unzulässigkeit des Bestreitens mit Nichtwissen wurde der Beklagte seitens der Klägerin hingewiesen (vgl. Replik vom 10.10.2017, Blatt 114 ff. (115)).
b) Die Kammer ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die seitens der Klägerin geltend gemachten Schadenspositionen allesamt haftungsausfüllend kausal auf den sich in den unterschiedlichen Wohnungen zeigenden Wasserschäden beruhen und die Klägerin einen Anspruch in Höhe von 472.293,86 € hat. aa) Die mit dem Wasserschaden vom 02.04.2012 geltend gemachten Schäden in Höhe von 215.278,00 € in den Wohnungen Nr. 12 und Nr. 4 beruhen haftungsausfüllend kausal auf den Wasserschäden. (1) Die Klägerin kann Schadensersatz in Höhe der Regressforderung der J-Versicherung (Anlage K25) in Höhe von 49.498,54 € ersetzt verlangen.
Die Positionen der Regressforderung wurden seitens des Beklagten hinsichtlich der haftungsausfüllenden Kausalität bestritten. Insbesondere hinsichtlich der Wohnung 4 wurde die Kausalität aus dem Schadensereignis vom 02.04.2012 bestritten. Hinsichtlich dieser beweisbedürftigen Tatsachen ist die Klägerin beweisbelastet.
Hierzu hat die Beweisaufnahme durch Einvernahme der Zeugin M ergeben, dass die J-Versicherung auf den am 02.04.2012 gemeldeten Schaden 49.498,54 € gezahlt hat, unter anderem bestehend aus Mietausfällen für die Wohnungen 4 und 12, Leckageortungskosten der Firma S. und Bewegungskosten. Die Zeugin konnte außerdem bekunden, dass die Versicherung einen eigenen Regulierer zum Schadensobjekt rausgeschickt habe, der den Wasserschaden festgestellt habe, die Ursache des Schadens jedoch auch für die Versicherung zunächst unklar geblieben sei. Die Zahlungen seien aufgrund des Wasserschadens erfolgt. Erst nach weiteren Nachforschungen des Generalunternehmers habe man die Ursache in falsch verpressten T-Stücken gefunden. Diese Schäden habe die Versicherung sodann bei der B GmbH regressiert. Die Aussage war auch glaubhaft. Die Zeugin hat zwar als Versicherungsangestellte ständig mit der Regulierung von Schadensfällen zu tun, jedoch konnte sie nach eigenem Einblick in die Versicherungsunterlagen die Schritte der Regulierung der Schäden skizzieren und erinnerte sich, trotz der erheblich vergangenen Zeit, an die schwierige Gemengelage zwischen den beteiligten Firmen und den Eigentümern. Ausweislich der Anlage K25 war sie auch die damalige Sachbearbeiterin, die die Ansprüche gegenüber der B GmbH geltend machte. Die Zeugin war glaubwürdig. Sie hat keinerlei Interesse am Ausgang des Verfahrens und auch sonst keine einseitigen Belastungstendenzen gezeigt. Hinsichtlich der in der Regressforderung enthaltene Mietausfallkosten hatte der Beklagte die Länge der Unbewohnbarkeit bestritten. Die Beweisaufnahme hat jedoch ergeben, dass die Wohnung Nr. 12 sowie die Wohnung Nr. 4 des Ehepaars T von April 2012 bis März 2013 nicht bewohnbar gewesen ist. Dies haben die Zeugen T, N und O übereinstimmend ausgesagt. Die Zeugen waren glaubwürdig. Sie haben keinerlei Interesse am Ausgang des Verfahrens, da nach übereinstimmender Aussage damals alle Forderungen beglichen wurden. Insbesondere der Zeuge N lebt auch bereits nicht mehr im streitgegenständlichen Haus und hat hiermit keine Berührungspunkte mehr.
Vor dem Hintergrund vergleichbarer Fälle ist es für die Kammer glaubhaft, dass sich die Zeugen nach mehr als zehn Jahren noch an das Schadensereignis erinnern konnten. Die Arbeiten haben sich mehrere Monate bis hin zu einem Jahr hingezogen. In dieser ganzen Zeit konnten die Mieter/Eigentümer teilweise nicht in ihrer Wohnung leben und die Zeugen bekundeten, dass die Beseitigung der Schäden nicht nur in zeitlichen Hinsicht ungewiss war, sondern auch, ob dies überhaupt möglich ist, weil möglicherweise nicht alle Schäden gefunden werden können. Dass es sich hierbei um ein bemerkenswertes Ereignis handelte, das sowohl für Mieter als auch für Eigentümer, insbesondere aufgrund getätigter Investitionen und Schimmelgefahr, bedeutsam war, hat sich in der Verhandlung dadurch gezeigt, dass alle Zeugen, obwohl diese teilweise nur (ehemalige) Mieter waren, nach mehr als zehn Jahren noch Unterlagen zu den Schäden und den Untersuchungsberichten der Schimmelinstitute hatten und diese mit zur Verhandlung brachten.
Einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht vermag die Kammer nicht zu erkennen, denn die Beweisaufnahme hat ergeben, dass die Wohnung Nr. 4 akut von einem Wasserschaden betroffen war. Der Zeuge O hat ausgesagt, dass er im Januar 2012 eingezogen sei und sich die durchnässten Wände erst im April zeigten. Die Wohnung war also zum Zeitpunkt des Einzugs nach dem unstreitigen Wasserschaden von November 2011 wieder komplett hergestellt und bezugsfertig. Dass es zu einem weiteren Wasserschaden gekommen ist, der (erneut) die Wohnung Nr. 4 betraf und sich jedoch erst im April zeigte, hat die Vernehmung des Zeugen H ergeben. Dieser hat ausgesagt, dass die Wasserschäden wohnungsübergreifend sichtbar wurden und dass auch Stellen, die bereits saniert waren, aufgrund eindringenden Wassers aus anderen Quellen eine neue Sanierung erforderlich machten. Indizien, dass die Klägerin der Schadensbeseitigung erst vier Monate nach Entdeckung des Schadens nachgekommen ist, sind nicht ersichtlich. Dass sich auch in Wohnung 12 der Schaden erst im März 2012 zeigte und es im April zu einer Schadensmeldung gekommen ist, haben die Zeugen N und T übereinstimmend ausgesagt. Sie konnten sich sogar noch daran erinnern, dass der Zeuge T seinen Mieter N bat, den Mangel selbst gegenüber der Klägerin anzuzeigen, da er selbst noch im Urlaub war.
(2) Ersatzfähig sind auch die Sanierungskosten und die sonstigen Kosten in Höhe von 165.779,46 €, die aufgrund der Wasserschäden angefallen sind. Die Kammer ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme auch davon überzeugt, dass die Kosten der Leckageortung (Anlagen K27-K29), die Sachverständigenkosten des Sachverständigenbüros K (Anlage K38) und die erhöhten Stromkosten (Anlage 40) kausal auf dem Wasserschaden in den Wohnungen 4 und 12 beruhen. Der Zeuge H hat in der mündlichen Verhandlung bekundet, dass die Klägerin zum Auffinden der Lecks in den wasserführenden Rohren des Gebäudes spezielle Leckageortungsfirmen habe beauftragen müssen, weil die Löcher schwer zu finden gewesen seien. Es habe dedektivische Arbeit geleistet werden müssen, da teilweise nur Tröpfchen aus den Leitungen entwichen seien. Dies habe auch dazu geführt, dass bereits zum reinen Auffinden der Löcher einzelne Wände oder sogar Wohnungen teilweise vollständig zurückgebaut werden mussten. Soweit der Beklagte die Kosten des Sachverständigen K als unverständlich rügt, da diese vermeintlich vor dem Schadensfall entstanden seien, ist dieser Einwand bereits deshalb unbegründet, da die Sachverständige K in der mündlichen Verhandlung bekundet hat, für die Wohnungen 4 und 12 einen Ortstermin am 23.01.2013 durchgeführt zu haben, mithin ein Dreivierteljahr nach dem Schaden im April 2012. Dass es zu erneuten Schimmelpilzuntersuchungen in der Wohnung 4 gekommen ist, erklärt sich ebenfalls aufgrund des erneuten Wassereindringens. Die Kammer ist ebenfalls davon überzeugt, dass ein erhöhter Strombedarf angefallen ist und erforderlich war, um die Wände zu trocknen oder die Geräte der Sanierungsfirmen zu betreiben. Ebenso war der Ein- und Ausbau der Einbauküchen erforderlich, um die Wohnungen sanieren zu können. Gleiches gilt für die Bewegungskosten und Einlagerungskosten, da ein Umzug in Übergangsquartiere und die Einlagerung von Möbeln aufgrund der Sanierungsarbeiten notwendig gewesen ist.
Die Klägerin kann auch die Kosten verlangen, bei denen es sich nicht um Schadensposten handelt, die zur Mangelbeseitigung erforderlich waren, sondern um sonstige Schadensposten, die durch den Wasserschaden entstanden sind, weil die Einrichtung der Mieter beschädigt worden ist oder weil die Wohnungen unbewohnbar gewesen sind, mithin die Ausbesserung der vom Wasser beschädigten Schränke der Mieter T. Die Kammer ist aufgrund der Aussage der Zeugen N, T und P auch davon überzeugt, dass die maßangefertigten Möbel der Mieter T vom Wasser beschädigt und teilweise zerstört wurden. Dies haben die Zeugen übereinstimmend ausgesagt. Der Zeuge P hat der Kammer während seiner Aussage Fotos von durch Wasser beschädigten Möbeln gezeigt, wobei es sich um die gleichen Möbel handelte, die auch der Zeuge T auf den in der Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 03.03.2023 befindlichen Bilder gezeigt hat. Der Zeuge P hat in Übereinstimmung mit den Zeugen N und T bekundet, dass es ursprünglich geplant gewesen sei, dass die Mieter T wieder in die Wohnung zurückziehen, wenn der Schaden behoben ist. Daher zogen die Mieter zuerst bei der Schwiegermutter des Zeugen T ein, ein Teil der Möbel wurde eingelagert, ein Teil zur Firma P verbracht, dies hat auch der Zeuge T bekundet. Erst nachdem erhebliche Zeit verstrichen war und immer noch nicht absehbar war, wann die Wohnung wieder bezogen werden konnte, haben die Mieter T zum Ende des Jahres 2012 gekündigt und sind in die Neubergstraße gezogen, so der Zeuge N. Hieraus resultieren auch die zweimaligen Umzugskosten, Einlagerungskosten und Kosten der Reparatur und Umarbeitung der Möbel für die neue Wohnung. Der Zeuge N hat insoweit bekundet, dass erst im April 2013 absehbar war, dass die Wohnung zum Mai wieder neu vermietet werden konnte, weshalb insoweit auch noch nach dem Auszug der Mieter T Mietausfall geltend gemacht wurde. Auch die Zeugen W machten Kosten für eine Ersatzunterkunft geltend.
bb) Die Klägerin kann auch die Kosten des Wasserschadens vom 11.09.2012 in der Wohnung 10 in Höhe von 74.734,14 € ersetzt verlangen.
Die Kammer ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ebenfalls davon überzeugt, dass die von der Klägerin geltend gemachten Kosten der Firma S, die Anmietung einer Ersatzwohnung für die Mieter L bei dem Vermieter F für drei Monate aufgrund des Wasserschadens angefallen sind, sowie die Nebenkosten, die in der geschädigten Wohnung für Strom angefallen sind. Dass auch eine erneute Raumluftuntersuchung durch das Sachverständigenbüro K erforderlich war, hat die Beweisaufnahme zur vollen Überzeugung der Kammer ergeben. Die damals tätige Sachverständige K hat bekundet, dass sie die Wohnung 10 zwei Mal, nämlich am 25.02.2013 und am 01.03.2013, untersuchen musste, da die Konzentration der Sporen beim ersten Ortstermin noch nicht gering genug gewesen sei. Die Zeugin konnte ihr Vorgehen widerspruchsfrei aus ihren Unterlagen erklären und die Zusammenhänge erläutern.
Bei den Kosten für die Firma G. handelt es sich um die Sanierungskosten der Wohnungen 4, 10 und 12. Das hat die Aussage des Zeugen H ergeben, der bekundet hat, dass die Firma G. ein ortsansässiger Generalunternehmer gewesen sei, den die Klägerin mit dem erneuten Ausbau der Wohnungen betraut habe, nachdem die beschädigten Wohnungen zu einem erheblichen Teil in den Rohbau hätten zurückgebaut werden müssen.
Aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme ist die Kammer auch von der haftungsausfüllenden Kausalität der anderen Schadenspositionen, der Positionen aus dem Wasserschaden vom 17.05.2012 bzw. 21.06.2012 in Höhe von 20.645,36 € überzeugt.
cc) Die Klägerin kann auch die allgemeinen Mehrkosten bestehend unter anderem aus Sachverständigenkosten, Kosten der Rechtsberatung und Personalkosten in Höhe von 161.636,36 € sowie die Kosten der Bürgschaft in Höhe von 2.611,53 € ersetzt verlangen.
(1) Die Sachverständigenkosten beruhen auch haftungsausfüllend kausal auf den Wasserschäden. Die Beweisaufnahme durch Vernehmung der Zeugen H und K hat ergeben, dass die Vielzahl an Sachverständigen dadurch zustande kam, dass die Klägerin immer den Sachverständigen kurzfristig engagierte, der zum Zeitpunkt des Auftretens eines neuen Wasserschadens freie Kapazitäten hatte, um ihrer Nachbesserungspflicht nachzukommen. Dies war erforderlich, da sich die Leckageortung und Schadensbeseitigung über mehrere Monate hinzog. Soweit die Eigentümer eigene Sachverständige für die Schimmeluntersuchungen beauftragt haben, hat die Beklagte nicht noch einmal extra Sachverständige hierfür beauftragt.
(2) Die geltend gemachten Schadenspositionen für die Leckageortung, Sanierung und Sachverständigenkosten waren erforderlich und in der Höhe vertretbar, um die Schaden zu beseitigen. Ein Sachverständigengutachten zur Ortsüblichkeit und Angemessenheit der Kosten war nicht einzuholen.
Der Bundesgerichtshof hat in seiner Rechtsprechung zum Prognoserisiko ausgeführt, dass für die Frage der Erforderlichkeit von Mangelbeseitigungskosten darauf abzustellen ist, was der Besteller im Zeitpunkt der Mangelbeseitigung als vernünftiger, wirtschaftlich denkender Bauherr — beide Parteien der vorliegend zitierten Entscheidung waren Unternehmer — aufgrund sachkundiger Beratung oder Feststellung aufwenden konnte und musste, wobei es sich um vertretbare Maßnahmen der Schadensbeseitigung handeln muss (BGH, Urteil vom 31.01.1991, Az. VII ZR 63/90). Nach der Rechtsprechung des OLG Karlsruhe trifft den schadensersatzpflichtigen Unternehmer sogar das Risiko, wenn der Dritte dem Geschädigten unnötige Arbeiten in Rechnung stellt, überhöhte Preise oder Arbeitszeit in Ansatz bringt oder Arbeiten berechnet, die in dieser Weise nicht ausgeführt worden sind (OLG Karlsruhe, Urteil vom 19.10.2004, Az. 17 U 107/04). Die Frage, ob ein vernünftig, wirtschaftlich denkender Bauherr die Arbeiten für erforderlich halten durfte, ist eine Rechtsfrage und keine Beweisfrage, die einer sachverständigen Begutachtung bedürfe (vgl. OLG Bamberg, Urteil vom 01.04.2005, Az. 6 U 42/04). Die Rechtsprechung geht auch davon aus, dass die Kosten, die durch einen den Mangel beseitigenden Dritten entstehen immer höher sein werden, als diejenigen Kosten, die dem Auftragnehmer für die Reparatur erwachsen wären. Hieraus zieht die Rechtsprechung den Schluss, dass selbst dann, wenn die vom Drittunternehmer für die Mangelbeseitigung in Rechnung gestellte Vergütung das Doppelte oder Dreifache der Kosten ausmacht, die dem Schadensversursacher entstehen würden, nicht ohne weiteres angenommen werden könne, dass die Aufwendungen das Erforderliche übersteigen (OLG Bamberg, Urteil vom 01.04.2005, Az. 6 U 42/04; OLG Dresden BauR 2000, 1341).
(3) Die Klägerin kann auch die Kosten der Rechtsberatung in Höhe von 45.080,00 € ersetzt verlangen.
Die Kammer ist nach der Zurückverweisung lediglich an das Urteil, nicht aber an die vom Berufungsgericht getätigten Hinweise gebunden, soweit das Berufungsgericht hierauf im Urteil nicht ausdrücklich Bezug genommen hat. Die Parteien können neue Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen, soweit §§ 295, 296 ZPO nicht entgegenstehen.
Bis zuletzt vertreten die Parteien hinsichtlich der Ersatzfähigkeit der Rechtsanwaltskosten ausschließlich unterschiedliche Rechtsansichten. Die Ausführungen der Klägerin, dass die geltend gemachten Kosten der Rechtsverfolgung im vorliegenden Fall erforderlich und angemessen waren ist vom Beklagten nicht bestritten worden (vgl. mit weiteren Nachweisen zum Sach- und Streitstand Seite 3 f. des Hinweisbeschlusses, Blatt 340 ff. der Akte).
Hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten auf Basis einer Honorarvereinbarung wird vertreten, dass in Ausnahmefällen auch Vergütungen auf Basis einer Honorarvereinbarung erstattungsfähig sind, wenn der Geschädigte diese Aufwendungen wegen der besonderen Lage des Falls für erforderlich und zweckmäßig halten durfte. Dies kann anzunehmen sein, wenn ein zur Vertretung bereiter und geeigneter Rechtsanwalt zu den gesetzlichen Gebühren, etwa wegen der Aufwändigkeit des Rechtsstreits und des geringen Streitwerts oder wenn ein geeigneter Rechtsanwalt zu den gesetzlichen Gebühren nicht gefunden werden kann (BGH, Urteil vom 16.07.2015, Az. IX ZR 197/14 = NJW 2015, 3447, Rn. 58; BGHZ 144, 343 (346) = NJW 2000, 2669).
Unter Beachtung dieser Grundsätze geht die Kammer nunmehr davon aus, dass die Klägerin die Kosten der rechtlichen Beratung ersetzt verlangen kann. Die Beklagte hat eingewendet, dass die Klägerin als großes Hoch- und Tiefbauunternehmen mit eigener Rechtsabteilung die Rechtsanwaltskosten wohl nicht als erforderlich betrachten durfte. Die im Hinweisbeschluss zitierte Rechtsprechung des BGH, Urteil vom 06.05.2014, Az. I ZR 2/03, bezieht sich auf Abmahnungen im Wettbewerbsrecht und damit um viele exakt gleich gelagerte Fälle in denen standardisierte Abmahnschreiben versandt werden. Nach nochmaliger Prüfung sieht die Kammer einen erheblichen Unterschied zu der Schadensabwicklung im vorliegenden Fall.
(4) Die Klägerin kann die Personalkosten in Höhe von 33.711,66 € ersetzt verlangen. Der begehrte Betrag von 44.010,00 € war um die Personalnebenkosten zu reduzieren, da es sich hierbei um Sowiesokosten handelt.
Soweit die Parteien um die Ersatzfähigkeit von Personalkosten streiten, ist hierzu auszuführen, dass im Grundsatz davon auszugehen ist, dass Personalkosten nicht erstattungsfähig sind, auch wenn die Arbeitszeit für eine gewinnbringende Tätigkeit hätte aufgewandt werden können. Der Verkehr rechnet eine Mühewaltung, wie bei der Feststellung von Ursachen und bei der Abwicklung eines Schadensfalles zum eigenen Pflichtenkreis des Geschädigten (BGH, Urteil vom 28.02.1969, Az. II ZR 154/67 = NJW 1969, 1109). Diese Grundsätze gelten nicht nur für den Privatmann oder kleine Unternehmen, sondern auch für größere Unternehmen. Personalkosten sind nicht schon deshalb ersatzfähig, weil Personal bei der Feststellung oder Abwicklung eines Schadens tätig gewesen ist (BGH, Urteil vom 31.05.1976, Az. II ZR 133/47).
Ein Anspruch kommt erst dann und soweit in Betracht, als er die Arbeit des Personals im Rahmen allgemeiner Verwaltungstätigkeit überschritten hat. Dies ist anzunehmen, wenn es zur Feststellung oder Abwicklung eines Schadens notwendig ist, einen oder mehrere Mitarbeiter für einen gewichtigen Zeitraum von ihrer üblichen Tätigkeit freizustellen (BGH, ebenda). Aus herangezogener Rechtsprechung ergibt sich gerade nicht, dass als kumulative Voraussetzung hinzutreten muss, dass der Geschädigte seinen Angestellten anders gewinnbringend hätte einsetzen können (OLG Düsseldorf, NJW RR 2001,739 + BGH 31.05.1976, NJW 1977, 35; OLG Schleswig NZBau 2018, 431 = ZfBR 2018, 510; BGH Urt. v. 31.05.1976, Az. II ZR 133/74, NJW 1977, 35; OLG Schleswig, Urt. v. 19.12.2017, Az. 3 U 15/17, NZBau 2018, 431; OLG Düsseldorf, Az. 22 U 130/00, NJW-RR 2001, 739). Vielmehr dürfte die Rechtsprechung derart zu verstehen sein, dass Personalkosten in drei Konstellationen ersatzfähig sind. Erstens, wenn der Geschädigte einen Angestellten extra zur Schadensabwicklung eingestellt hat (OLG Hamm, Urteil v. 08.02.2018, Az. 21 U 95/15, Rn 86; BGH Urteil vom 31.05.1976, Az. II ZR 133/47 = NJW 1977, 35), zweitens, soweit dargelegt und bewiesen wird, dass der Angestellte gewinnbringend woanders hätte eingesetzt werden können (OLG Schleswig, Urt. v. 19.12.2017, Az. 3 U 15/17, ZfBR 2018, 510 (514); BGH, Urt. v. 28.02.1969, Az. II ZR 154/67) oder drittens, soweit die Schadensabwicklung die Mühewaltung derart überschreitet, dass der Geschädigte einen Angestellten in erheblichem Umfang zur Schadensabwicklung abstellen musste (BGH Urteil vom 31.05.1976, Az. II ZR 133/47 = NJW 1977, 35; BGH, Beschl. v. 20.09.2016, Az. VIII ZR 239/15 = EnWz 2016, 567 (567)). Dass die Voraussetzungen nicht kumulativ vorliegen müssen, folgt für die Kammer daraus, dass die Voraussetzungen in keiner der zitierten Entscheidungen oder in der Literatur kumulativ genannt werden und dürfte wohl vor dem Hintergrund gerechtfertigt sein, dass die Rechtsprechung mit dem Erfordernis, dass der Umfang der Tätigkeit erheblich sein muss, die Ersatzfähigkeit einschränkt. Ein Hinzutreten, dass die Mitarbeiter in einem derart erheblichen Umfang dann nicht gewinnbringend hätten eingesetzt werden können, dürfte es dann nicht mehr benötigen, da man davon ausgehen darf, dass ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen keinen Mitarbeiter beschäftigt, der mit einem erheblichen Teil seiner Arbeit nicht gewinnbringend eingesetzt werden kann. Der Vortrag der Klägerin legt die dritte Konstellation dar.
Zu der Frage, wann ein gewichtiger Zeitraum vorliegt, finden sich indes in der Rechtsprechung keine allgemeingültigen Anhaltspunkte zur Bemessung. Der BGH hat jedoch in seiner Entscheidung vom 28.02.1969, Az. II ZR 154/67 einen langen Zeitrum bereits bei circa 14 Tagen angenommen (BGH, Urteil vom 28.02.1969, Az. II ZR 154/67), wobei dies je nach Schadensfall unterschiedlich zu beurteilen sein wird. Die Klägerin hat in ihrer Anlage K82 zusammengestellt, dass sechs Mitarbeiter in unterschiedlichem Umfang am streitgegenständlichen Objekt gearbeitet haben. Konkret haben die sechs Mitarbeiter über 15 Monate insgesamt 709 Stunden an dem Objekt aufgewendet, um die Mängel zu beseitigen bzw. die Mangelbeseitigung zu überwachen. Setzt man dies ins Verhältnis zu einer normalen 40-Stundenwoche eines Angestellten, mithin 160 Stunden im Monat bzw. 2400 Stunden in 15 Monaten, ergibt sich, dass die Schadensabwicklung zumindest die Arbeitskraft eines Angestellten über einen erheblichen Zeitraum von 15 Monaten 29,5 % Arbeitskraft gebunden hat.
Nicht erstattungsfähig sind jedoch die Sowiesokosten in Form von Beiträgen des Arbeitgebers zur Berufsgenossenschaft, Haftpflichtversicherung, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Betriebliche Altersversorgung. Unstreitig lagen die Lohnnebenkosten in den Jahren 2012 und 2013 bei circa 23,4 %, sodass die Kammer eine geeignete Schätzgrundlage hat, um die Höhe des Schadens nach § 287 Abs. 1 ZPO schätzen zu können.
c) Die Klage war im Übrigen abzuweisen. Die Klägerin hat ihren Klageantrag im der Klageschrift vom 02.05.2017 mit 534.702,27 € beziffert, obwohl sie ihn nur in Höhe von 485.205,73 € dargelegt hat. In der mündlichen Verhandlung vom 28.09.2019 wurde der Antrag unter Bezugnahme auf die Klageschrift gestellt.
Eine Beschränkung des Klageantrags auf die Leistung aus der Versicherungsforderung war vorzunehmen, da die Kammer an die Anträge der Parteien gebunden ist, § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO.
2. Die Klägerin hat auch Anspruch auf Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank seit dem 20.06.2017, §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2, 247 BGB.
II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung hinsichtlich der vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 1 und 2 ZPO.